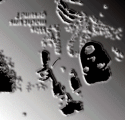NZZ am Sonntag, 11.06.2006, Ressort Wissen, Autorin: Irene Dietschi, Hervorhebungen durch Sesam Watch
«Uns geht es um das Zusammenspiel von Erbe und Umwelt»
Jürgen Margraf leitet das Forschungsprojekt «Sesam»: 3000 Kinder sollen vorgeburtlich und bis zum 20. Lebensjahr untersucht werden, um die Entstehung von psychischer Gesundheit besser zu verstehen. Gentech-Gegner werfen dem Projekt «eugenische Tendenzen» vor. Der Angegriffene antwortet.
NZZ am Sonntag: Herr Professor Margraf, warum braucht es eine Studie, welche die Entstehung psychischer Erkrankungen untersucht?
Jürgen Margraf: Psychische Gesundheit beeinflusst unser Wohlbefinden mehr als die körperliche. Störungen der psychischen Gesundheit treten im Lauf des Lebens bei jedem zweiten Menschen einmal auf, das heisst, jede Familie ist mehr oder minder betroffen. Psychische Gesundheit ist auch mit hohen Kosten verbunden, und es geht um die Frage, wie man den Betroffenen besser hilft. In der Schweiz gibt es jährlich etwa dreimal so viele Suizide wie Verkehrstote - rund 1500 gegenüber 500 -, und wenn man vergleicht, was aufgewendet wird, um Verkehrsunfälle beziehungsweise Suizide zu reduzieren, kommt man auf ein krasses Missverhältnis. Verkürzt gesagt sind es Milliarden gegen ein paar Telefon-Hotlines. Das ist nicht gerechtfertigt und wird dem Leiden der Angehörigen nicht gerecht.
NZZ am Sonntag: Was hat das Projekt «Sesam» also vor?
Jürgen Margraf: «Sesam» möchte drei Dinge tun: Erstens herausfinden, welches die Schutzfaktoren sind, die psychische Gesundheit bewirken. Diese werden in der Forschung viel zu wenig berücksichtigt, deshalb sind sie unser erstes Ziel. Das zweite: Wir wollen die kritischen Konstellationen im Lebenskontext verstehen, und zwar in der ganzen Bandbreite, von der Biologie bis zur Soziologie. Wir isolieren nicht einzelne Faktoren, sondern es geht um das Zusammenspiel. Denn es gibt viele Gründe für die Annahme, dass sich die verschiedenen Faktoren in ihrer Gesamtheit gegenseitig beeinflussen. Der dritte Punkt schliesslich ist eigentlich der Sinn des Ganzen: Was wir tun, soll Grundlagen liefern für ein besseres Verständnis, aber auch für eine bessere Prävention und Therapie psychischer Störungen.
NZZ am Sonntag: Nehmen psychische Erkrankungen zu?
Jürgen Margraf: Die Bedeutung psychischer Störungen nimmt zu - was nicht automatisch heisst, dass auch die Häufigkeit steigt. Wenn etwa Infektionskrankheiten seltener werden, steigt die relative Bedeutung anderer Krankheiten. Ein anderer Aspekt: Die ökonomischen Bedingungen sind härter geworden, das heisst, Firmen können es sich weniger leisten, «schwierige» Angestellte an Bord zu behalten. Deshalb haben wir einen sehr starken Anstieg der IV-Renten aufgrund psychischer Störungen.
Ob Depressionen häufiger geworden sind, ist unter Experten umstritten, mit Sicherheit zugenommen haben aber die Angststörungen. Ursachen sind unter anderem die angestiegenen Scheidungsraten, das Auseinanderbrechen der traditionellen Familienstrukturen. Das betrifft vor allem Kinder:
Das durchschnittliche Kind heute - nicht das kranke! - hat einen höheren Angstwert als das durchschnittliche kinderpsychiatrisch hospitalisierte Kind in den 50er Jahren.
NZZ am Sonntag: Gegen «Sesam» hat sich heftiger Widerstand formiert. Der Basler Appell gegen Gentechnologie will das Projekt sistieren mit dem Argument, es werde «fremdnützige Forschung an Kindern» betrieben, und das sei unzulässig.
Jürgen Margraf: Das ist ein ganz problematischer Begriff, den ich so nicht stehen lassen kann. Es ist in der Forschung die Regel, dass es keinen direkten Nutzen gibt für denjenigen, der heute an einer Studie teilnimmt. Auch das geplante Humanforschungsgesetz hält diesen Grundsatz fest. Man macht Forschung für einen Erkenntnisgewinn, der dann anderen Menschen zugute kommt. Wenn man das verbieten möchte, muss man sich im Klaren sein, dass man den allergrössten Teil von Forschung verbietet. Die Behauptung, «fremdnützige» Forschung bei Kindern sei verboten, ist deshalb klar falsch.
Denken Sie an Pisa oder an die Leukämie-Forschung: Von Pisa profitieren künftige Schülergenerationen. Und heute können drei Viertel aller an Leukämie erkrankten Kinder geheilt werden, weil damals Eltern ihre Einwilligung gaben, dass das Blut ihrer Kinder untersucht wurde. Mit welchem Recht sollen bei der Erforschung psychischer Krankheiten Einschränkungen gemacht werden, die man bei körperlichen Krankheiten nicht macht?
NZZ am Sonntag: Dem Projekt werden sogar eugenische Tendenzen vorgeworfen. Sowohl Ihr Kollege, der Psychoanalytiker
Theodor Cahn, wie auch der Ethiker
Klaus Peter Rippe äusserten sich entsprechend.
Jürgen Margraf: Das ist ein ungeheurer Vorwurf. Herrn Rippe habe ich zum persönlichen Gespräch eingeladen, um ihn aus erster Hand zu informieren. Wie auch übrigens den Basler Appell, der aber verlauten liess, man komme nur zusammen mit der Presse. Der Vorwurf wird den Opfern der Nazi-Verbrechen in keiner Weise gerecht, er kann sogar als Verharmlosung der Untaten wirken. Er wird mit keinerlei Belegen untermauert, es handelt sich offenbar um die simple Analogie: genetische Untersuchungen gleich Eugenik - bloss weil bei einem der Teilprojekte ein DNA-Test verwendet wird. Das ist mehr als fragwürdig. Uns geht es ja ums Zusammenspiel von Erbe und Umwelt, nicht um «die Gene».
NZZ am Sonntag: Man wirft Ihnen auch ein reduktionistisches Menschenbild vor.
Jürgen Margraf: Das ist auch so ein Kampfbegriff: Man versucht den anderen zu diskreditieren, indem man ihm ein reduktionistisches Menschenbild vorwirft. Wo soll das aber herkommen? Wo sind die Belege, dass wir technokratisch, biologistisch oder was auch immer sind? Wir haben bei «Sesam» Biologie dabei - ist man deswegen biologistisch?
Wir haben Soziologie dabei - sind wir deswegen sozialistisch? Oder Psychologie - sind wir also psychologisierend? Es ist ein Witz. Wir haben zum Beispiel den führenden Medizinsoziologen Johannes Siegrist an Bord, wir mussten ihn im Ausland rekrutieren - und müssen uns nun anhören, wir seien zu wenig sozial! Wäre der Begriff nicht so abgedroschen, würde ich sagen: «Sesam» ist ganzheitlich.
NZZ am Sonntag: Zur Studie: Bei «Sesam» ist die Rede von einer «Kernstudie» und zwölf Teilstudien. Was wird da genau erforscht?
Jürgen Margraf: Die Kernstudie ist die Basis für alle Teilstudien: Wir möchten 3000 Familien in Hinblick auf Entwicklung und psychische Gesundheit begleiten, nicht nur die Kinder, sondern auch Eltern und Grosseltern. Unser Ansatz ist interdisziplinär und methodisch divers. Die Informationen, die dort erhoben werden, sind die Basis für Teilstudien, in denen Teilaspekte untersucht werden, zum Beispiel das elterliche Gedächtnis: Wie detailgetreu behalten Eltern Lebensereignisse und Verhaltensweisen ihres Kindes in Erinnerung? Eine Teilstudie untersucht die Blinzelreaktionen von Säuglingen: Gibt es eine Verbindung zu späterem Suchtverhalten? Eine weitere Teilstudie hier in Basel geht der Frage nach, ob und wie sich Stress während der Schwangerschaft auf die Entwicklung des Kindes auswirkt.
NZZ am Sonntag: Wie soll diese Untersuchung vonstatten gehen?
Jürgen Margraf: Es wird vor allem das Verhalten des Kindes beobachtet, und zwar schon im Mutterleib, bei der routinemässigen Ultraschall-Untersuchung in der 20. Schwangerschaftswoche. Wie aktiv ist das Kind? Welchen Schlaf-Wach- Rhythmus hat es? Die Gruppe um Wolfgang Holzgreve, der die Studie leitet, möchte im Grunde das Qualitätsmanagement des Ultraschalls verbessern. Die Forschungsfrage von «Sesam» ist dabei ein Zusatznutzen.
In einem anderen Projekt wird mit Hilfe des Computers ein Elektrokardiogramm des ungeborenen Kindes erstellt. Auf dieser Basis können wir die vegetative Labilität untersuchen - einen der klassischen Risikofaktoren für den ganzen Bereich von affektiven und Angststörungen, auch Sucht. Diese Werte bringen wir dann zusammen mit dem Stress-Erleben der Mutter während der Schwangerschaft und können so sehen, wie sich das später beim Kind auswirkt. Entwickelt es Verhaltensauffälligkeiten, welche Faktoren helfen, welche schaden möglicherweise? Das ist sehr spannend.
NZZ am Sonntag: Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern können doch verschiedenste Ursachen haben. Und je mehr Faktoren an einem Phänomen beteiligt sind, desto schwieriger wird es, sie auseinander zu halten, das heisst, eine statistische Signifikanz für einen einzelnen Faktor zu finden.
Jürgen Margraf: Man kann die Faktoren für den Einzelfall nicht auseinander halten. Wir können höchstens über Gruppen Aussagen machen, denn bei grossen Gruppen ergibt sich im Durchschnitt ein aussagekräftiges Resultat. Wir können jedoch keine individuellen Risikoprofile herausgeben. Das wäre auch ethisch hoch problematisch. Wir arbeiten nur mit anonymisierten Daten und nur auf der Ebene von Gruppen.
NZZ am Sonntag: Auf der Homepage von «Sesam»
werden bereits interessierte Familien angesprochen, die im Frühling 2007 ein Kind erwarten. Glauben Sie wirklich, dass Sie zu jenem Zeitpunkt starten können? Es heisst, die kantonalen Ethikkommissionen seien nicht involviert worden.
Jürgen Margraf: Das ist auch so ein Vorwurf, der jeglicher Grundlage entbehrt, die Ethikkommission beider Basel etwa war von Anfang an über «Sesam»
informiert. Ich rechne nicht mit Schwierigkeiten, sondern bin zuversichtlich, dass wir plangemäss starten können.
NZZ am Sonntag: Wie wollen Sie die 3000 Familien 20 Jahre lang bei der Stange halten? Was bekommen die für ihren Aufwand?
Jürgen Margraf: Sie sprechen die wichtigste Frage von Langzeitstudien an: Wie viele Studienteilnehmer bleiben langfristig dabei? Wenn viele dabeibleiben, sind die Aussagen gut verallgemeinerbar; wenn viele wegbleiben, bleibt unklar, welche Selektionsprozesse mit im Spiel sind, und man kann die Erkenntnisse nicht mehr verallgemeinern. Die Schweiz hat bei Langzeitstudien ganz hohe Erfolgswerte, wie sie in anderen Ländern nie realisiert wurden. Die Langzeitstudie von Herrn Schöpf zur Schizophrenie hatte nach 22 Jahren eine Wiederteilnahmerate von 92 Prozent, die Zürcher Longitudinalstudien von Remo Largo weisen einen ähnlich hohen Wert auf. Die Schweiz hat eine stabile Bevölkerung, die gegenüber Forschung im Allgemeinen positiv eingestellt ist, und wenn die Untersuchungen interessant sind, dann kommt man gerne wieder. Eine weitere Rolle spielt, ob die Untersuchungen aufwendig und invasiv sind. Das ist bei «Sesam» nicht der Fall. Über Blut- und Speichelproben hinaus haben wir keine invasiven Untersuchungen. Unser Ziel ist es, dass am Ende der Studie 70 Prozent noch dabei sind. Das ist realistisch.
Forschungsschwerpunkt «Sesam»
Der Nationale Forschungsschwerpunkt «Sesam» (Swiss Etiological Study of Adjustment and Mental Health) hat sich der Erforschung psychischer Gesundheit verschrieben. Dabei sollen 3000 Kinder ab der 12. Schwangerschaftswoche bis zum 20. Altersjahr regelmässig untersucht und befragt werden. «Sesam» besteht aus 1 Kern- und 12 Teilstudien, an denen Forschende der Universitäten Basel, Bern, Freiburg, Zürich und Trier (D) beteiligt sind. Vorgeburtlich sind (nichtinvasive) Ultraschalluntersuchungen geplant, bei der Geburt werden Speichelproben für einen DNA-Test entnommen; ein einziges der 12 Teilprojekte befasst sich mit der Genetik («Der Einfluss genetischer Faktoren auf Entwicklung und Verlauf psychischer Erkrankungen»). Andere Teilstudien widmen sich etwa der Bedeutung der Grosseltern oder den gesellschaftlichen Einflüssen auf die Familie. Dafür sind Interviews mit den Grosseltern, Eltern und Kindern vorgesehen. Von «Sesam» erhoffen sich die Forschenden Einsicht darüber, was zur psychischen Gesundheit beiträgt, welche Faktoren Depressionen und Angststörungen begünstigen. Leiter des Projektes ist Jürgen Margraf, 50, Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie in Basel. Das Budget der ersten Phase bis 2008 beträgt 23 Millionen Franken.
patpatpat - 12. Jun, 08:58
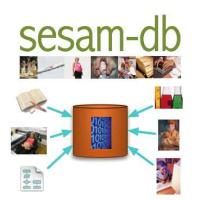 Die Website von Sesam
Die Website von Sesam