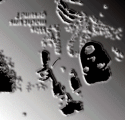NZZ: "Rechtliche Grenzen wissenschaftlicher Forschung an Kindern"
In der NZZ ist der folgende Essay von Kurt Seelmann, Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Basel und Daniel Kipfer, Richter am Bundesstrafgericht in Bellinzona, heute auf S. 65 unter dem Label "Zeitfragen" zu finden:
Der Zweck heiligt auch bei der Forschung nicht die Mittel
Forschung an Menschen darf grundsätzlich nur erfolgen, wenn die Betroffenen darin einwilligen. Heikel wird es bei Kindern, die rechtlich als urteilsunfähig gelten. Die Juristen Seelmann und Kipfer analysieren die Rechtslage und erkennen in der neuen Gesetzgebung die Tendenz, die Menschenwürde mit der Forschungsfreiheit abzuwägen, was unstatthaft sei.
Wissenschaftliche Forschung an Menschen ist als solche ein politisch umstrittenes und sensibles Thema. Sie wirft ethische, gesellschafts- und rechtspolitische, vor allem aber auch rechtliche Fragen im engeren Sinne auf. Insbesondere die Forscher verlangen Rahmenbedingungen, welche die rechtlich im Prinzip verbürgte Freiheit der Forschung möglichst wenig tangieren. Das ist angesichts der hochrangigen Ziele vieler Forschungsvorhaben verständlich. Auf der anderen Seite muss das Recht auch diejenigen schützen, an denen geforscht wird. Der Zweck heiligt - auch bei der Forschung - nicht die Mittel. In besonderer Weise problematisch ist die Forschung an urteilsunfähigen Kindern, da diese nicht in der Lage sind, selbst gültig in Forschungen an ihrer Person einzuwilligen. Wie umstritten die Thematik ist, zeigte sich etwa im letzten Frühjahr, als in Basel innert kürzester Zeit 10 000 Unterschriften gegen das sozialpsychologisch-medizinische Forschungsprojekt Sesam gesammelt wurden. Mit diesem Projekt sollen in einer Langzeitstudie an 4000 Kindern und ihren Eltern und Grosseltern die Voraussetzungen psychischer Erkrankungen erforscht werden.
Tangierung der persönlichen Integrität
Gegenwärtig ist die Forschung am Menschen rechtlich primär in kantonalen Gesetzen geregelt. Einschlägig sind auch Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) sowie internationale Übereinkommen. Projekte zur Forschung am Menschen werden zumeist von kantonalen Ethikkommissionen geprüft; die Rechtsgrundlagen sind, auch bei Forschung an Urteilsunfähigen, nicht einheitlich. Der eidgenössische Gesetzgeber hat dies als unbefriedigend erkannt und deshalb verschiedene Gesetzgebungsprojekte auf den Weg gebracht (Heilmittelgesetz, bereits in Kraft; Bundesgesetz über die genetische Untersuchung beim Menschen, verabschiedet, noch nicht in Kraft; Humanforschungsgesetz und Verfassungsartikel, Vernehmlassung abgeschlossen). In all diesen Gesetzen wird auch die wissenschaftliche Forschung an oder die Untersuchung von Kindern geregelt.
«Forschungsuntersuchungen am Menschen greifen in das Recht der Persönlichkeit ein. Solche Eingriffe bedürfen der Rechtfertigung.» So heisst es, rechtlich korrekt, in den medizinethischen Richtlinien der SAMW. Die persönliche Integrität von Probanden kann, je nach Versuchsanlage, durch wissenschaftliche Forschungsprojekte in mehrfacher Hinsicht tangiert sein: physisch, psychisch oder in einem generellen Sinne im Hinblick auf die Autonomie; spezifisch ist zum Beispiel die informationelle Selbstbestimmung zu nennen, welche durch wissenschaftliche Erhebung von Daten zur Person betroffen sein kann.
Informiert sein und selbst bestimmen
Dies erklärt, weshalb Humanforschungsprojekte bestimmten Regeln zu genügen haben, deren Einhaltung von Ethikkommissionen überwacht wird: Das Forschungsprojekt soll zum Beispiel einem bestimmbaren Nutzen dienen, und die Schwere des Eingriffs in die Persönlichkeitssphäre der Probanden muss dazu in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Schliesslich, und das ist hier entscheidend, müssen die Probanden über die mit dem Forschungsprojekt verbundenen Eingriffe umfassend informiert sein und darin einwilligen. Das Gebot des «informed consent» ist Konsequenz des dem Recht zugrunde liegenden Selbstbestimmungsprinzips. Der urteilsfähige informierte Erwachsene kann als Proband gültig sowohl in Forschung einwilligen, die ihm selbst Nutzen bringen könnte (therapeutische Forschung), als auch in Forschung, von der nur andere einen Nutzen erwarten dürfen (sogenannte drittnützige Forschung).
Anders stellt sich die Lage jedoch für Urteilsunfähige und insbesondere für Kinder dar. Soll ein Kind an einem Forschungsprojekt mitwirken, hat dessen gesetzlicher Vertreter einzuwilligen. Die stellvertretende Einwilligung ist jedoch auf der Basis allgemeiner Rechtsgrundsätze nur zulässig, wenn die Einwilligung im wohlverstandenen Interesse des Vertretenen selbst liegt, wenn das Kind selbst also einen Nutzen zu erwarten hat. Die Rechtmässigkeit des Eingriffs beruht hier nämlich nicht auf der autonomen Einwilligung des Kindes, da es eine solche eben nicht gibt, sondern auf dem Umstand, dass dieses Fehlen der Autonomie den Interessen des Kindes nicht schaden darf - es soll keine «therapeutische Waise» werden.
Daraus folgt, dass es eine gültige stellvertretende Einwilligung in die mit einem Forschungsprojekt verbundenen Risiken für den Urteilsunfähigen nur geben kann, wenn es sich um ein therapeutisches Forschungsprojekt handelt, ein Projekt also, von dem der Betroffene selbst einen Nutzen erwarten kann. Nur ein solcher kann denkmöglich in seinem Interesse liegen. Oder mit anderen Worten: Die drittnützige Forschung an Urteilsunfähigen dürfte, wenn sie in deren Rechtssphäre eingreift, in jedem Fall unzulässig sein. Denn sie beruht weder auf einer autonomen Einwilligung des Betroffenen noch auf der vom Gedanken des Kindeswohls getragenen stellvertretenden Einwilligung. Die Beachtung mittelbarer Nutzeneffekte (zum Beispiel, drittnützige Forschung an Urteilsunfähigen ermögliche auch drittnützige Forschung für sie, oder das Gefühl, altruistisch gewirkt zu haben, schaffe später Befriedigung) verbietet sich, da auf diese Weise jegliche Instrumentalisierung legitimiert werden könnte - was, soweit ersichtlich, niemand will.
Besonderer Schutz
Was wurde bisher hinsichtlich der Forschung an Kindern vorgesehen oder bereits entschieden? Aus der Botschaft für das bereits in Kraft gesetzte Heilmittelgesetz (HMG) geht hervor, dass Urteilsunfähige besonderen Schutz geniessen sollen. Das Gesetz lässt deshalb klinische Versuche mit Heilmitteln an Urteilsunfähigen nur unter restriktiven Bedingungen zu. Bedenklich erscheint gleichwohl die Möglichkeit, klinische Versuche mit Urteilsunfähigen und Kindern unter bestimmten Voraussetzungen - der Eingriff darf höchstens minimal sein - auch dann zuzulassen, wenn für die Probanden kein Nutzen zu erwarten ist (Art. 55 HMG). Vor dem Hintergrund des davor weitgehend anerkannten Verbots drittnütziger Forschung an Urteilsunfähigen stellt sich die Frage, ob diese Bestimmung noch verfassungskonform ist. Vom Europarat wurde sie lediglich als Mindestschutzstandard vorgegeben und keineswegs den Mitgliedsstaaten angeraten.
Nicht direkt anwendbar für die wissenschaftliche Forschung ist das Bundesgesetz über die genetische Untersuchung am Menschen (verabschiedet, aber noch nicht in Kraft), da damit nicht die wissenschaftliche Forschung, sondern die genetische Untersuchung des Erbguts - unabhängig von wissenschaftlichen Forschungsinteressen - geregelt wird. Soweit Forschung jedoch auf genetische Untersuchungen als Datenbasis Bezug nimmt, muss die Datenerhebung diesem Gesetz doch wohl auch genügen. In den Artikeln 5 und 10 wird vorgeschrieben, dass bei Urteilsunfähigen das genetische Material nur untersucht werden darf, wenn der gesetzliche Vertreter umfassend informiert ist und eingewilligt hat und wenn die Untersuchung für den Schutz der Gesundheit des Betroffenen notwendig ist. Die einzige, restriktiv umschriebene Ausnahme einer Untersuchung mit ausschliesslichem Drittnutzen ist vorgesehen für den Fall, dass die Belastung der Familie mit einer schweren Erbkrankheit nicht anders abgeklärt werden kann.
Erhebliche Bedenken beim neuen Gesetz
Eine umfassende eidgenössische Regelung soll die Forschung am Menschen nun mit dem Humanforschungsgesetz (HFG) und der auch neu zu erlassenden Verfassungsbestimmung erfahren. Beide Vorlagen, deren Vernehmlassung soeben abgeschlossen wurde, müssen erhebliche Bedenken wecken - entfernen sie sich doch noch weiter von dem Grundsatz, dass Menschen nicht ohne ihren Willen instrumentalisiert werden dürfen. Der neu vorgeschlagene Art. 118a der Bundesverfassung (BV) lautet in Abs. 1: «Der Bund erlässt Vorschriften über die Forschung am Menschen im Gesundheitsbereich. Er sorgt dabei unter Beachtung der Forschungsfreiheit für den Schutz der Menschenwürde und der Persönlichkeit.» Dieser Formulierung scheint ein Missverständnis zugrunde zu liegen: dass Forschungsfreiheit und Menschenwürde als gleichrangige Rechte gegeneinander abgewogen werden könnten. Dem ist jedoch nicht so.
Während die Forschungsfreiheit ein nach den üblichen Regeln beschränkbares und damit gleichsam «gewöhnliches» Grundrecht ist, handelt es sich bei der Garantie der Menschenwürde um die Bedingung der Möglichkeit einer freiheitlichen Rechtsordnung, die deshalb der Abwägung gegen andere Grundrechte nicht zugänglich ist und sein darf. Systematisch entspricht sie Kants kategorischem Imperativ, welcher gebietet, dass die Person niemals bloss als Mittel, sondern stets als Selbstzweck zu betrachten und zu behandeln sei. Oder mit den Worten des Staatsrechtlers Günter Dürig: «Die Menschenwürde ist als solche getroffen, wenn der konkrete Mensch zum Objekt, zu einem blossen Mittel, zu einer vertretbaren Grösse herabgewürdigt wird.» Es kann mithin nicht zulässig sein, unter Berufung auf die Forschungsfreiheit die Würde der Person durch deren Instrumentalisierung zu verletzen.
Der gelegentlich zu hörende Einwand, es gehe doch auch um die Würde der künftig von der Forschung Profitierenden, greift zu kurz: Würdebeeinträchtigung durch Krankheit rechtfertigt nicht Würdeverletzungen durch Menschen. Am krassen Beispiel: «Verbrauchende» Forschung an einem Menschen wäre auch dann nicht legal, wenn man sicher wüsste (was bei Forschung zudem per definitionem nie der Fall ist), dass man damit vielen Menschen Qualen ersparen und das Leben retten könnte. Dürfte man Würde verrechnen, wäre dieses Ergebnis nicht verständlich.
Illiberaler Gedanke
Die zumindest missglückte Formulierung von Abs. 1 suggeriert demgegenüber die Abwägbarkeit von Menschenwürde und scheint sie auf Verfassungsstufe festzuschreiben. Es überrascht deshalb nicht, dass die konkretisierenden Bestimmungen in Art. 118a BV sowie im HFG selbst das Instrumentalisierungsverbot teilweise verletzen. So soll es nach Abs. 2 lit. b - in Anlehnung an die Formulierung im Heilmittelgesetz - möglich sein, Forschung an Urteilsunfähigen zu betreiben, auch wenn diese keine Verbesserung ihrer Gesundheit erwarten können.
Der Entwurf ist offenbar von dem letztlich illiberalen Gedanken nicht ganz unbeeinflusst, die Forschung gegen die als störende Einschränkung empfundene Menschenwürdegarantie schützen zu müssen. Dafür spricht nicht nur die hier verhandelte Thematik der drittnützigen Forschung an Urteilsunfähigen als Teilsozialisierung des menschlichen Körpers, sondern sprechen auch die neu vorgesehene Möglichkeit der zwangsweisen Forschung an Urteilsunfähigen und weitere ungewöhnliche Möglichkeiten. Man mag all das für sinnvoll halten, muss sich aber klar sein, dass man damit bis vor kurzem kaum bezweifelte Rechtsgrundsätze über Bord wirft. Dem Ansehen der dringend nötigen und lebenrettenden seriösen Forschung tut man damit keinen Gefallen.
Der Zweck heiligt auch bei der Forschung nicht die Mittel
Forschung an Menschen darf grundsätzlich nur erfolgen, wenn die Betroffenen darin einwilligen. Heikel wird es bei Kindern, die rechtlich als urteilsunfähig gelten. Die Juristen Seelmann und Kipfer analysieren die Rechtslage und erkennen in der neuen Gesetzgebung die Tendenz, die Menschenwürde mit der Forschungsfreiheit abzuwägen, was unstatthaft sei.
Wissenschaftliche Forschung an Menschen ist als solche ein politisch umstrittenes und sensibles Thema. Sie wirft ethische, gesellschafts- und rechtspolitische, vor allem aber auch rechtliche Fragen im engeren Sinne auf. Insbesondere die Forscher verlangen Rahmenbedingungen, welche die rechtlich im Prinzip verbürgte Freiheit der Forschung möglichst wenig tangieren. Das ist angesichts der hochrangigen Ziele vieler Forschungsvorhaben verständlich. Auf der anderen Seite muss das Recht auch diejenigen schützen, an denen geforscht wird. Der Zweck heiligt - auch bei der Forschung - nicht die Mittel. In besonderer Weise problematisch ist die Forschung an urteilsunfähigen Kindern, da diese nicht in der Lage sind, selbst gültig in Forschungen an ihrer Person einzuwilligen. Wie umstritten die Thematik ist, zeigte sich etwa im letzten Frühjahr, als in Basel innert kürzester Zeit 10 000 Unterschriften gegen das sozialpsychologisch-medizinische Forschungsprojekt Sesam gesammelt wurden. Mit diesem Projekt sollen in einer Langzeitstudie an 4000 Kindern und ihren Eltern und Grosseltern die Voraussetzungen psychischer Erkrankungen erforscht werden.
Tangierung der persönlichen Integrität
Gegenwärtig ist die Forschung am Menschen rechtlich primär in kantonalen Gesetzen geregelt. Einschlägig sind auch Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) sowie internationale Übereinkommen. Projekte zur Forschung am Menschen werden zumeist von kantonalen Ethikkommissionen geprüft; die Rechtsgrundlagen sind, auch bei Forschung an Urteilsunfähigen, nicht einheitlich. Der eidgenössische Gesetzgeber hat dies als unbefriedigend erkannt und deshalb verschiedene Gesetzgebungsprojekte auf den Weg gebracht (Heilmittelgesetz, bereits in Kraft; Bundesgesetz über die genetische Untersuchung beim Menschen, verabschiedet, noch nicht in Kraft; Humanforschungsgesetz und Verfassungsartikel, Vernehmlassung abgeschlossen). In all diesen Gesetzen wird auch die wissenschaftliche Forschung an oder die Untersuchung von Kindern geregelt.
«Forschungsuntersuchungen am Menschen greifen in das Recht der Persönlichkeit ein. Solche Eingriffe bedürfen der Rechtfertigung.» So heisst es, rechtlich korrekt, in den medizinethischen Richtlinien der SAMW. Die persönliche Integrität von Probanden kann, je nach Versuchsanlage, durch wissenschaftliche Forschungsprojekte in mehrfacher Hinsicht tangiert sein: physisch, psychisch oder in einem generellen Sinne im Hinblick auf die Autonomie; spezifisch ist zum Beispiel die informationelle Selbstbestimmung zu nennen, welche durch wissenschaftliche Erhebung von Daten zur Person betroffen sein kann.
Informiert sein und selbst bestimmen
Dies erklärt, weshalb Humanforschungsprojekte bestimmten Regeln zu genügen haben, deren Einhaltung von Ethikkommissionen überwacht wird: Das Forschungsprojekt soll zum Beispiel einem bestimmbaren Nutzen dienen, und die Schwere des Eingriffs in die Persönlichkeitssphäre der Probanden muss dazu in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Schliesslich, und das ist hier entscheidend, müssen die Probanden über die mit dem Forschungsprojekt verbundenen Eingriffe umfassend informiert sein und darin einwilligen. Das Gebot des «informed consent» ist Konsequenz des dem Recht zugrunde liegenden Selbstbestimmungsprinzips. Der urteilsfähige informierte Erwachsene kann als Proband gültig sowohl in Forschung einwilligen, die ihm selbst Nutzen bringen könnte (therapeutische Forschung), als auch in Forschung, von der nur andere einen Nutzen erwarten dürfen (sogenannte drittnützige Forschung).
Anders stellt sich die Lage jedoch für Urteilsunfähige und insbesondere für Kinder dar. Soll ein Kind an einem Forschungsprojekt mitwirken, hat dessen gesetzlicher Vertreter einzuwilligen. Die stellvertretende Einwilligung ist jedoch auf der Basis allgemeiner Rechtsgrundsätze nur zulässig, wenn die Einwilligung im wohlverstandenen Interesse des Vertretenen selbst liegt, wenn das Kind selbst also einen Nutzen zu erwarten hat. Die Rechtmässigkeit des Eingriffs beruht hier nämlich nicht auf der autonomen Einwilligung des Kindes, da es eine solche eben nicht gibt, sondern auf dem Umstand, dass dieses Fehlen der Autonomie den Interessen des Kindes nicht schaden darf - es soll keine «therapeutische Waise» werden.
Daraus folgt, dass es eine gültige stellvertretende Einwilligung in die mit einem Forschungsprojekt verbundenen Risiken für den Urteilsunfähigen nur geben kann, wenn es sich um ein therapeutisches Forschungsprojekt handelt, ein Projekt also, von dem der Betroffene selbst einen Nutzen erwarten kann. Nur ein solcher kann denkmöglich in seinem Interesse liegen. Oder mit anderen Worten: Die drittnützige Forschung an Urteilsunfähigen dürfte, wenn sie in deren Rechtssphäre eingreift, in jedem Fall unzulässig sein. Denn sie beruht weder auf einer autonomen Einwilligung des Betroffenen noch auf der vom Gedanken des Kindeswohls getragenen stellvertretenden Einwilligung. Die Beachtung mittelbarer Nutzeneffekte (zum Beispiel, drittnützige Forschung an Urteilsunfähigen ermögliche auch drittnützige Forschung für sie, oder das Gefühl, altruistisch gewirkt zu haben, schaffe später Befriedigung) verbietet sich, da auf diese Weise jegliche Instrumentalisierung legitimiert werden könnte - was, soweit ersichtlich, niemand will.
Besonderer Schutz
Was wurde bisher hinsichtlich der Forschung an Kindern vorgesehen oder bereits entschieden? Aus der Botschaft für das bereits in Kraft gesetzte Heilmittelgesetz (HMG) geht hervor, dass Urteilsunfähige besonderen Schutz geniessen sollen. Das Gesetz lässt deshalb klinische Versuche mit Heilmitteln an Urteilsunfähigen nur unter restriktiven Bedingungen zu. Bedenklich erscheint gleichwohl die Möglichkeit, klinische Versuche mit Urteilsunfähigen und Kindern unter bestimmten Voraussetzungen - der Eingriff darf höchstens minimal sein - auch dann zuzulassen, wenn für die Probanden kein Nutzen zu erwarten ist (Art. 55 HMG). Vor dem Hintergrund des davor weitgehend anerkannten Verbots drittnütziger Forschung an Urteilsunfähigen stellt sich die Frage, ob diese Bestimmung noch verfassungskonform ist. Vom Europarat wurde sie lediglich als Mindestschutzstandard vorgegeben und keineswegs den Mitgliedsstaaten angeraten.
Nicht direkt anwendbar für die wissenschaftliche Forschung ist das Bundesgesetz über die genetische Untersuchung am Menschen (verabschiedet, aber noch nicht in Kraft), da damit nicht die wissenschaftliche Forschung, sondern die genetische Untersuchung des Erbguts - unabhängig von wissenschaftlichen Forschungsinteressen - geregelt wird. Soweit Forschung jedoch auf genetische Untersuchungen als Datenbasis Bezug nimmt, muss die Datenerhebung diesem Gesetz doch wohl auch genügen. In den Artikeln 5 und 10 wird vorgeschrieben, dass bei Urteilsunfähigen das genetische Material nur untersucht werden darf, wenn der gesetzliche Vertreter umfassend informiert ist und eingewilligt hat und wenn die Untersuchung für den Schutz der Gesundheit des Betroffenen notwendig ist. Die einzige, restriktiv umschriebene Ausnahme einer Untersuchung mit ausschliesslichem Drittnutzen ist vorgesehen für den Fall, dass die Belastung der Familie mit einer schweren Erbkrankheit nicht anders abgeklärt werden kann.
Erhebliche Bedenken beim neuen Gesetz
Eine umfassende eidgenössische Regelung soll die Forschung am Menschen nun mit dem Humanforschungsgesetz (HFG) und der auch neu zu erlassenden Verfassungsbestimmung erfahren. Beide Vorlagen, deren Vernehmlassung soeben abgeschlossen wurde, müssen erhebliche Bedenken wecken - entfernen sie sich doch noch weiter von dem Grundsatz, dass Menschen nicht ohne ihren Willen instrumentalisiert werden dürfen. Der neu vorgeschlagene Art. 118a der Bundesverfassung (BV) lautet in Abs. 1: «Der Bund erlässt Vorschriften über die Forschung am Menschen im Gesundheitsbereich. Er sorgt dabei unter Beachtung der Forschungsfreiheit für den Schutz der Menschenwürde und der Persönlichkeit.» Dieser Formulierung scheint ein Missverständnis zugrunde zu liegen: dass Forschungsfreiheit und Menschenwürde als gleichrangige Rechte gegeneinander abgewogen werden könnten. Dem ist jedoch nicht so.
Während die Forschungsfreiheit ein nach den üblichen Regeln beschränkbares und damit gleichsam «gewöhnliches» Grundrecht ist, handelt es sich bei der Garantie der Menschenwürde um die Bedingung der Möglichkeit einer freiheitlichen Rechtsordnung, die deshalb der Abwägung gegen andere Grundrechte nicht zugänglich ist und sein darf. Systematisch entspricht sie Kants kategorischem Imperativ, welcher gebietet, dass die Person niemals bloss als Mittel, sondern stets als Selbstzweck zu betrachten und zu behandeln sei. Oder mit den Worten des Staatsrechtlers Günter Dürig: «Die Menschenwürde ist als solche getroffen, wenn der konkrete Mensch zum Objekt, zu einem blossen Mittel, zu einer vertretbaren Grösse herabgewürdigt wird.» Es kann mithin nicht zulässig sein, unter Berufung auf die Forschungsfreiheit die Würde der Person durch deren Instrumentalisierung zu verletzen.
Der gelegentlich zu hörende Einwand, es gehe doch auch um die Würde der künftig von der Forschung Profitierenden, greift zu kurz: Würdebeeinträchtigung durch Krankheit rechtfertigt nicht Würdeverletzungen durch Menschen. Am krassen Beispiel: «Verbrauchende» Forschung an einem Menschen wäre auch dann nicht legal, wenn man sicher wüsste (was bei Forschung zudem per definitionem nie der Fall ist), dass man damit vielen Menschen Qualen ersparen und das Leben retten könnte. Dürfte man Würde verrechnen, wäre dieses Ergebnis nicht verständlich.
Illiberaler Gedanke
Die zumindest missglückte Formulierung von Abs. 1 suggeriert demgegenüber die Abwägbarkeit von Menschenwürde und scheint sie auf Verfassungsstufe festzuschreiben. Es überrascht deshalb nicht, dass die konkretisierenden Bestimmungen in Art. 118a BV sowie im HFG selbst das Instrumentalisierungsverbot teilweise verletzen. So soll es nach Abs. 2 lit. b - in Anlehnung an die Formulierung im Heilmittelgesetz - möglich sein, Forschung an Urteilsunfähigen zu betreiben, auch wenn diese keine Verbesserung ihrer Gesundheit erwarten können.
Der Entwurf ist offenbar von dem letztlich illiberalen Gedanken nicht ganz unbeeinflusst, die Forschung gegen die als störende Einschränkung empfundene Menschenwürdegarantie schützen zu müssen. Dafür spricht nicht nur die hier verhandelte Thematik der drittnützigen Forschung an Urteilsunfähigen als Teilsozialisierung des menschlichen Körpers, sondern sprechen auch die neu vorgesehene Möglichkeit der zwangsweisen Forschung an Urteilsunfähigen und weitere ungewöhnliche Möglichkeiten. Man mag all das für sinnvoll halten, muss sich aber klar sein, dass man damit bis vor kurzem kaum bezweifelte Rechtsgrundsätze über Bord wirft. Dem Ansehen der dringend nötigen und lebenrettenden seriösen Forschung tut man damit keinen Gefallen.
patpatpat - 12. Aug, 09:55