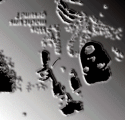Titel:
«Es wäre viel mehr Bescheidenheit angesagt»
Theodor Cahn, Chefarzt der Kantonalen Psychiatrischen Klinik in Liestal, übt Kritik am Projekt sesam der Uni Basel
Theodor Cahn wurde 1943 in Basel geboren. Hier absolvierte er auch hauptsächlich seine Ausbildung. Er ist Psychiater und Psychotherapeut psychoanalytischer Richtung. Seit 1978 ist er Chefarzt der Kantonalen Psychiatrischen Klinik Liestal. Er wird Ende nächsten Jahres pensioniert. Cahns Hauptinteresse gilt der Sozialpsychiatrie und der Psychotherapie im psychiatrischen Milieu. Cahn ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.
Interview: Patrick Marcolli und Stefan Stöcklin
baz: Herr Cahn, das Projekt sesam untersucht im Kern das Thema Depressionen, möchte darüber mehr erfahren und forschen. Die Frage an Sie als Psychiater: Wie schätzen Sie dieses Vorhaben ein?
Theodor Cahn: Ich weiss nicht, wie spezifisch das Projekt zu Depressionen ist. Es möchte ja die psychische Gesundheit des Menschen als Ganzes erfassen. Die prospektiv angelegte epidemiologische Studie mit 3000 Probanden ist eine faszinierende Art, an die Fragestellung heranzugehen. Soweit man informiert ist, zielt das Projekt jedoch primär auf statistische Resultate ab. Da muss man sich fragen: Was kann mit einer solchen Methode ausgesagt werden - und was nicht?
Braucht es diese Forschung? Ist ein Projekt nötig, das primär zum Ziel hat, mehr über Depressionen zu erfahren?
Man kann statistisch abgestützte Aussagen zur Depression erwarten, die vielleicht schon Bekanntes bestätigen oder Unbekanntes zu Tage fördern. Aber Depression ist nichts Einheitliches. Depression nennen wir ein Zustandsbild, das in den unterschiedlichsten Zusammenhängen vorkommen kann. Ein grosser Teil der Depressionen ist erlebnisbedingt, ein kleiner Teil - das weiss man ziemlich genau - hat einen starken konstitutionell-genetischen Hintergrund.
Und gerade hier setzt die Studie ja an.
Ich glaube nicht, dass man am Ende - wie das suggeriert wird - einen Durchbruch haben wird in Bezug auf die Kenntnisse über Depressionen. Ich glaube auch nicht, dass dieser Durchbruch überhaupt zu erwarten ist, wie zum Beispiel der Durchbruch bei Infektionskrankheiten, wo eine einheitliche Ursache, ein Erreger vorliegt.
Warum nicht?
Man kann Depression auch als Reaktionsmöglichkeit aller Menschen betrachten, ähnlich wie Angst oder Trau er - mit den verschiedensten Ursa chen und Auswirkungen. Sehr viel geschieht durch Anstoss von aussen. Und dann gibt es Depressionen, bei denen nur noch die Eigendynamik erkennbar ist und nicht mehr ihr Ursprung. Depressivität gehört sozusagen zur menschlichen Ausrüstung. Die Depression als einheitliche Krankheit gibt es nicht.
Sie warnen also vor zu hohen Erwartungen an das Projekt sesam.
Ja. Was mich sehr stört ist die Art, wie die Studie auf den Markt gebracht wird.
Weshalb?
Weil grosse Hoffnungen erweckt werden und ziemlich apodiktisch gesagt wird, das und das werde diesen und jenen Nutzen haben, man werde daraus Prävention ableiten können, Mechanismen erkennen und wesentliche Schritte machen, um den Menschen in seiner psychischen Entwicklung besser zu verstehen und zu erfassen. Da wäre meines Erachtens viel mehr Bescheidenheit angebracht. Natürlich werden dank sesam einige statistische Zusammenhänge und wohl neue Hypothesen gefunden. Sehr oft können solche Resultate aber ziemlich trivial ausfallen.
Implizit gehen die Verantwortlichen noch weiter und suggerieren, dass es aufgrund der Resultate in Zukunft möglich sein wird, Kosten im Gesundheitswesen zu sparen.
Das ist reine Propaganda. Woher wissen die denn das?
sesam stösst gerade auch in Kreisen von Psychoanalytikern auf grossen Widerstand. Wie erklären Sie sich das?
Die Psychoanalyse stützt sich auf ein ganz anderes Menschen- und Forschungsbild. Die Analytiker - auch ich zähle mich dazu - versuchen zu erfassen, was ein Mensch erlebt und was ihn unbewusst bewegt. Was stellt ein Mensch als autonomes Wesen und als Subjekt dar? Über Messdaten findet man dazu kaum Zugang. Der Ansatz, den wir bei sesam sehen - wenigstens über die spärlichen Informationen, die bisher darüber veröffentlicht wurden -, geht auf diese Problematik nicht ein. Aber ich finde es eigentlich nicht gut, den ganzen Konflikt auf einen Schulen-Streit zu reduzieren.
Als Psychoanalytiker sagen Sie also, dass bei sesam ein zu einfaches Bild des Menschen transportiert wird?
Ja.
Ein Bild, das Ihrer Erfahrung aus der Praxis nicht gerecht wird?
Das kann man so sagen. Es wird sehr grob mit wichtigen Begriffen umgegangen. Auf der Homepage ist zum Beispiel nur von «Stress» als äusserem Wirkfaktor die Rede. Auf dieser groben Basis versprechen die Projektmacher sehr feine Resultate. Das ist keine Schulen-Frage: Auch aus einer biologischen oder kognitiven Sicht ist das zu simpel.
Sie haben vorhin von statistischen Zusammenhängen und neuen Hypothesen gesprochen, die dank sesam gefunden werden könnten. Was ist sonst noch möglich?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man dank der Studie einige Risikokomponenten besser erfassen kann. Aber ein Risiko wiederum ist eine statistische Grösse. Wie man damit umgeht und Prävention betreibt, ist problematisch. Prävention heisst ja, dass man eingreift, bevor etwas geschieht. Als Beispiel sei die Schizophrenie genannt. Dank epidemiologischer Forschung wissen wir heute, dass diese Krankheit einen langen Vorlauf hat. Zu Beginn sind aber die Zeichen, die man retrospektiv als Anfang dieser Krankheit ausmachen kann, unspezifisch: Konzentrationsverlust, Desinteresse etc. Es ist daher umstritten, in welchen Fällen wann eine Intervention angebracht ist, bevor ein klares Krankheitsbild erscheint. Wenn man die Leute mit Risikofaktoren früh erfassen und unter Beobachtung halten kann, ist das schon ein Fortschritt. Dazu kann diese Studie bei anderen psychischen Krankheiten vielleicht einen Beitrag leisten. So viel, aber auch nicht mehr.
Welche Gefahren sehen Sie da, gerade im Bereich Prävention?
Eine Gefahr besteht, wenn man an den Menschen mit einer Haltung der Machbarkeit und des Wissenschaftsglaubens herangeht und sich zu tief greifenden Eingriffen legitimiert fühlt.
Aus einem wissenschafts- oder psychiatriehistorischen Blick stechen einige fatale Parallelen ins Auge.
Ja, das ist klar. Sie meinen die Eugenik? Natürlich haben wir heute bessere Sicherungen im wissenschaftlichen Betrieb. Aber die Eugenik hat vor hundert Jahren ja nicht angefangen mit den Vernichtungsaktionen im Dritten Reich, sondern bei hochkarätigen, gutmeinenden Wissenschaftlern. Und doch hat das in gerader Linie in den Abgrund geführt.
Weckt sesam eugenische Assoziationen?
Ja, durchaus.
Oder könnte man sagen, das Projekt beruhe auf sehr faktengläubigem Gedankengut?
Ja, zum Beispiel in der Idee, dass man aufgrund von Destillaten (Augenzwinkern, Hirnbildern, alles in Kombination mit Fragebogen von Eltern und Grosseltern) ein Bild des Menschen aufbauen kann, aus dem sich viel ableiten lässt. Dies halte ich für überzogen.
Steckt ein naiver Ansatz hinter sesam?
Auf jeden Fall ist er einseitig. Warum können die Projektverantwortlichen nicht wissenschaftliche Bescheidenheit walten lassen? Ist das für die Geldbeschaffung nötig?
Wenn Sie auf die Geschichte der Psychiatrie zurückblicken: Überrascht Sie, dass jetzt eine solche Studie mit diesem fortschrittsgläubigen Ansatz kommt?
Nein, das ist natürlich Mainstream und überrascht so gesehen gar nicht. Das ist das, was in die hochkarätigen Zeitschriften kommt. Das muss man für akademische Karrieren vorweisen. Das ist die Wahrheit, die heute zählt. Vielleicht ist es auch ein Pendelausschlag in die Genauigkeit, als Gegenreaktion zur Beliebigkeit von vor zwei, drei Jahrzehnten. Überraschend ist, mit welcher Propagandamacht die Studie vorangetrieben wird.
Sie haben sich vorhin gegen einen SchulenStreit zwischen den verschiedenen psychologischen Richtungen verwahrt. Doch geht es nicht genau darum: Ein biologischer, klinischer Ansatz gegen die Tradition der analytischen Tiefenpsychologie?
Ich weiss nicht, ob man das so verallgemeinern darf. Aber Jürgen Margraf und sein Institut sind auch schon sehr aggressiv vorgegangen gegen die analytische Richtung.
Besteht nicht auch bei den Analytikern die Angst, an Boden zu verlieren?
Ja, aber auch bei den Humanwissenschaftlern. Der Schweizerische Nationalfonds, der Geldgeber, hat dieses Projekt ja als Teil der sozial- und geisteswissenschaftlichen Forschungsschwerpunkte verkauft. Aber die Humanwissenschaften kommen jetzt kaum vor. Im Grossen und Ganzen ist es ein naturwissenschaftliches Projekt der Life Sciences. Das hat vermutlich auch mit lokaler Wissenschaftspolitik und Taktik zu tun.
Die Verantwortlichen von sesam betonen die Bedeutung von Depressionen und die Zunahme von psychischen Störungen. Sehen Sie dies auch in Ihrer alltäglichen Praxis?
Ich denke, diese Zunahme ist dramatisiert. Wir stehen nicht plötzlich vor einer Lawine von Depressionen und brauchen nun eine Studie, die grosse Heilsversprechungen macht. Depressionen waren schon immer ein grosses Problem. Nur kann ich nicht bestätigen, dass die Fallzahlen in der letzten Zeit stark zugenommen hätten. Depressionen, Angst und Sucht waren schon immer und sind die häufigsten psychischen Störungen, mit denen wir zu tun haben. Sie sind ein grosses Problem der Volksgesundheit. Dass man da die Forschung fördert, ist grundsätzlich sehr zu begrüssen. Was hingegen deutlich zunimmt, ist die Nachfrage nach fachpsychiatrischen Diensten, hauptsächlich ambulant. Das hat wohl einfach auch damit zu tun, dass die Wahrnehmung für psychologisch bedingte oder gefärbte Krankheiten stärker geworden ist und die Diskriminierung der Psychiatrie abgenommen hat.
Projekt sesam
>Die Studie. Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) «sesam» hat zum Ziel, mehr über die Ursachen herauszufinden, die zu einer «gesunden psychischen Entwicklung» führen. Im Zentrum stehen Depressionen und Angststörungen. Kernpunkt des Projekts ist eine grossangelegte Studie an 3000 Kindern, die bereits vorgeburtlich ab der 12. Schwangerschaftswoche erfasst und bis zu ihrem 20. Lebensjahr begleitet werden sollen. Pränatal sind nicht invasive Untersuchungen via Ultraschall geplant, bei der Geburt sollen Speichelproben für DNA-Untersuchungen genommen werden, vorgesehen sind Interviews mit den Eltern, den Grosseltern und den Kindern. Dank dieser prospektiven Studie erhofft man sich mehr darüber zu erfahren, was zur psychischen Gesundheit beiträgt, welche inneren und externen Faktoren Depressionen und Angststörungen begünstigen.
Direktor des Forschungsschwerpunktes ist Jürgen Margraf, Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Basel, Geschäftsführerin ist Roselind Lieb, Professorin für Epidemiologie und Gesundheitspsychologie in Basel. Insgesamt sind an der Kernstudie 12 Teilstudien angehängt, neben der Universität Basel sind Forschende der Universitäten Bern, Freiburg, Zürich und Trier (D) beteiligt. Das Budget der ersten Phase von 2005-2008 beträgt knapp 23 Millionen Franken. Sesam ist die Abkürzung für «Swiss Etiological Study of Adjustment and Mental Health».
>Ethik. Wie alle Forschungsprojekte am Menschen braucht auch sesam die Zustimmung von Ethik-Experten der zuständigen Kommissionen in den betroffenen Kantonen. Bis jetzt hat die Ethik-Kommission beider Basel (EKBB) die zur Prüfung notwendigen Unterlagen nicht erhalten. Die Eingabe habe sich verzögert, weil Detailabklärungen nötig gewesen seien, wie es bei sesam heisst. Noch im Februar wurde von Seiten der Projektverantwortlichen eine Eingabe in den «nächsten Wochen» angekündet. Gemäss Plan sollte mit der Kernstudie diesen Herbst begonnen werden können. Ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, erscheint im Moment eher zweifelhaft. sts
patpatpat - 19. Mai, 11:12