Sesam in der FAZ am Sonntag
Sabine Löhr schrieb gestern in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über Sesam:
Die beste aller Welten für das Kind
„Steh auf!“ „Ich kann nicht.“ - „Geh einfach mal raus!“ „Ich kann nicht.“-“Hör auf zu heulen!“ „Ich kann nicht.“ - „Zieh dich an!“ „Ich kann nicht.“ - „Stell dich nicht so an!“ „Tu ich nicht.“ (Extrem daneben auch: „Lach doch mal!“)
Wenn das Leben bloß so einfach wäre, wie sich Menschen ohne Depression das vorstellen. Man versteckt sich nicht aus Koketterie hinter diesem dunklen Vorhang, um irgendwann fröhlich wieder hervorzuspringen. Depression ist trotz Brooke Shields oder Sebastian Deisler immer noch tabuisiert, Angststörungen werden als seelische Wehwehchen diffamiert. Die Folgen der psychischen Erkrankung sind aber gravierend: Bis zu 70 Prozent der Depressionsgeplagten leiden unter Selbstmordgedanken, traurige 30 Prozent versuchen sich an der Umsetzung. Psychische Störungen werden laut WHO bis 2020 zweithäufigster Grund vorzeitiger Sterblichkeit und massiver Lebensbeeinträchtigung sein. Vielleicht ein Grund, warum Gesundheitsministerin Ulla Schmidt die Bekämpfung von depressiven Erkrankungen als nationales Gesundheitsziel ausgerufen hat.
„Sesam“
Einen echten Schritt in diese Richtung will aber die Schweiz gehen. Sie finanziert als nationalen Forschungsschwerpunkt das Großprojekt „Sesam“ (“Swiss etiological study of adjustment and mental health“). Diese über 20 Jahre geplante Dreigenerationenstudie will an 3000 Familien untersuchen, wie das Zusammenwirken unterschiedlicher sozialer, psychologischer, biologischer und genetischer Faktoren die Gesundheit der Psyche beeinflußt.
Fortsetzung: siehe Kommentar
Die beste aller Welten für das Kind
„Steh auf!“ „Ich kann nicht.“ - „Geh einfach mal raus!“ „Ich kann nicht.“-“Hör auf zu heulen!“ „Ich kann nicht.“ - „Zieh dich an!“ „Ich kann nicht.“ - „Stell dich nicht so an!“ „Tu ich nicht.“ (Extrem daneben auch: „Lach doch mal!“)
Wenn das Leben bloß so einfach wäre, wie sich Menschen ohne Depression das vorstellen. Man versteckt sich nicht aus Koketterie hinter diesem dunklen Vorhang, um irgendwann fröhlich wieder hervorzuspringen. Depression ist trotz Brooke Shields oder Sebastian Deisler immer noch tabuisiert, Angststörungen werden als seelische Wehwehchen diffamiert. Die Folgen der psychischen Erkrankung sind aber gravierend: Bis zu 70 Prozent der Depressionsgeplagten leiden unter Selbstmordgedanken, traurige 30 Prozent versuchen sich an der Umsetzung. Psychische Störungen werden laut WHO bis 2020 zweithäufigster Grund vorzeitiger Sterblichkeit und massiver Lebensbeeinträchtigung sein. Vielleicht ein Grund, warum Gesundheitsministerin Ulla Schmidt die Bekämpfung von depressiven Erkrankungen als nationales Gesundheitsziel ausgerufen hat.
„Sesam“
Einen echten Schritt in diese Richtung will aber die Schweiz gehen. Sie finanziert als nationalen Forschungsschwerpunkt das Großprojekt „Sesam“ (“Swiss etiological study of adjustment and mental health“). Diese über 20 Jahre geplante Dreigenerationenstudie will an 3000 Familien untersuchen, wie das Zusammenwirken unterschiedlicher sozialer, psychologischer, biologischer und genetischer Faktoren die Gesundheit der Psyche beeinflußt.
Fortsetzung: siehe Kommentar
patpatpat - 19. Jun, 15:03
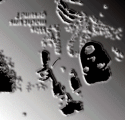


Das Ziel ist ehrgeizig
Die läuft auf vollen Touren. Nächster Schritt wird sein, die Kernstudie und zwölf Teilstudien zur Begutachtung bei den kantonalen Ethikkommissionen einzureichen, Probleme erwartet Margraf nicht (siehe: Sesam, öffne dich nicht!). Das Ziel ist ehrgeizig: „Die Hauptstudie soll die wichtigsten biopsychosozialen Risiko- und Schutzfaktoren parallel erfassen und in einen Querbezug setzen“, sagt Margraf, „diese Gesamtperspektive kann kein Forscher und keine Disziplin alleine leisten.“ Ultraschall, Verhaltensbeobachtung, Interviews, Fragebögen werden die wichtigsten Instrumente zur Datenerhebung sein, Speichel-, Blut- und Urinproben sollen biologisch-genetische Fragen klären. Sesam ist eine Aufgabe für Psychologen, Neurowissenschaftler, Soziologen, Mediziner, Biologen und Genetiker.
Das eine, überzeugende Modell für die Entstehung psychischer Erkrankungen gibt es eben nicht. Dafür herrscht zuviel Interaktion zwischen Physis und Psyche. Einfache Antworten wird auch Sesam nicht liefern können. Die spannendsten werden zu erwarten sein, wenn das Projekt zeigt, was uns und unsere Kinder, trotz aller bekannten Risikofaktoren, psychisch gesund hält.
Zusammenspiel der Generationen
Zwanzig Jahre sind lang, also raten wir mal: eine glückliche Familie. Sich nicht scheiden lassen, wenn die genetisch vorbelastete, pubertierende Tochter gerade die Schule wechselt. Tatsächlich gilt dem Zusammenspiel der Generationen die besondere Aufmerksamkeit der Forscher. Denn die Qualität familiärer Beziehungen hat maßgeblichen Einfluß auf die gesunde psychische Entwicklung von Kindern. Leidet etwa eine Mutter an Depressionen, tragen ihre Kinder zwar je nach Studie ein zwei- bis vierfaches Risiko, ebenfalls psychisch zu erkranken, sei es an Aufmerksamkeits-, häufiger noch aber an Angststörungen. Vor allem letztere können sich im Erwachsenenalter als Depressionen zeigen. Nach einer Studie der Universität Zürich quälen sich elf Prozent aller kleinen Eidgenossen zwischen 6 und 16 mit Angststörungen.
Doch „Die Gene!“ zu rufen wäre vorschnell. Sie erklären nicht, warum diese Störungen weltweit zunehmen. Und auch nicht, weshalb die psychischen Probleme von Kindern zurückgehen, wenn deren gemütskranke Mütter erfolgreich behandelt werden. Ähnlich positiv wirkt sich wohl die Anwesenheit gesunder Bezugspersonen, etwa Vater oder Großmutter, aus.
Ein Henne-Ei-Problem
Einige der Teilstudien wollen daher die Bedeutung der Großeltern, die Familienfunktionen sowie generationenübergreifende Risikomuster ausleuchten. Andere suchen nach einem Einfluß mütterlicher Stresshormone auf die Entwicklung des Fötus. Vielleicht finden sich dabei ja Hinweise, wie die statistische Korrelation zwischen unterdurchschnittlicher Körpergröße neugeborener Neunmonatskinder und der erhöhten Wahrscheinlichkeit, daß diese später verhaltensauffällig werden, zu erklären ist. Den hat die Epidemiologin Nicola Wiles bei der Analyse von Daten einer britischen Langzeitstudie gefunden, an der 4800 Kinder teilgenommen hatten. Für Frühchen war der Zusammenhang bereits vorher bekannt.
Und: Säuglinge von Frauen mit unbehandelter Wochenbettdepression sind häufiger passiver und reizbarer als Kinder von Dauerstrahlemüttern. Diese Winzlinge lächeln seltener, selbst als Zweijährige interessieren sie sich oft weniger für ihre Umwelt als der Durchschnitt. Vertrackterweise fallen manche Frauen aber gerade erst in diesen Postpartum-Blues, weil der ersehnte Neuankömmling sich in seinen ersten Erdenwochen scheinbar grundlos die Seele aus dem Leib schreit. Ein Henne-Ei-Problem, das alle unglücklich macht.
„Risikofamilien“
Offenbar müssen drei Übel zusammentreffen, um die Balance gesund und krank machender Faktoren zu stören: die generelle Anfälligkeit, ein konkreter Auslöser und aufrechterhaltende Bedingungen. Eine Teilstudie wird untersuchen, ob Kinder in „Risikofamilien“, in denen etwa die Beziehung der Eltern schlecht ist oder es diesen an Feinfühligkeit mangelt, bessere Chancen auf eine gesunde Entwicklung haben, wenn die Eltern an einem Sensitivitätstraining teilnehmen - nach Margraf eine erlaubte Intervention: „Weil es darum geht, Risiken zu reduzieren, erwarten wir positive Auswirkungen auf die Gesundheit.“
Ansonsten enthalten sich die Beobachter des Eingreifens, außer in schweren Fällen, etwa bei Suizidgefahr. Schön wäre, wenn es so gelänge, kindliche Probleme früh und sanft in den Griff zu bekommen. Niemand wünscht sich schließlich Zahlen wie aus den Vereinigten Staaten. Zwar ist nicht geklärt, in welchem Maße Kinder heute häufiger psychisch krank werden als früher. Doch nach einer Studie der Archives of General Psychiatry hat sich die Zahl der mit Psychopharmaka behandelten Kinder dort im letzten Jahrzehnt versechsfacht. Nur ein Drittel entfiel dabei auf Verhaltensstörungen, ein weiteres auf Gemütsstörungen. Und das, obwohl die bei Erwachsenen belegte Wirkung von Psychopharmaka bei Kindern ganz anders aussehen kann. Manchmal wirken sie gar nicht, andere haben sogar Suizidgedanken erst hervorgerufen. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und klinische Studien an ihnen selten.
Die beste aller Welten zu bieten
Präventive Maßnahmen zu entwickeln gehört nicht zu den Aufgaben von Sesam. Sicher werden andere in die Bresche springen, Psychologen, Therapeuten, vielleicht auch Pharmakologen. Hoffman la Roche hat Sesam sechs Millionen Franken zugesagt - „völlig ohne Bedingungen oder mögliche Einflußnahme, das Projekt ist einfach sinnvoll“, erklärt Katja Prowald, Pressechefin der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Pharmakonzerns. Lediglich im wissenschaftlichen Beratungsgremium darf ein Roche-Vertreter sitzen, und mehr als die sukzessive geplanten Veröffentlichungen soll das Unternehmen nicht zu sehen bekommen.
Ob sich daraus ein pharmakogenetischer Aufhänger für neue Medikamente ableiten lassen wird - vielleicht sogar für solche, die speziell auf Kinder zugeschnitten sind -, kann man nicht absehen. In schweren Fällen, wenn psychotherapeutische Maßnahmen versagen, kann der Medikamenteneinsatz auch bei Kindern sinnvoll sein. Vielleicht schaffen wir es ja einfach nicht, rechtzeitig alle Risikofaktoren zu eliminieren und unserem wie auch immer vorbelasteten Kind die beste aller Welten zu bieten. Aber Mühe kann man sich ja geben.