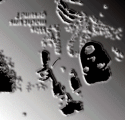Am "Workshop Elektronische Datentreuhänderschaft - Anwendungen, Verfahren, Grundlagen" anlässlich der Informatik 2006 in Dresden präsentierten die für die Datenbank von sesam verantwortlichen Boris Glavic und Klaus Dittrich am 5. Oktober 2006 ihr Paper mit dem Titel:
sesam: Ensuring Privacy for a Interdisciplinary Longitudinal Study
Abstract: Most medical, biological and social studies face the problem of storing information about subjects for research purposes without violating the subject’s privacy. In most cases it is not possible to remove all information that could be linked to a subject, because some of this information is needed for the research itself. This fact holds especially for longitudinal studies, which collect data about a subject at different times and places. Longitudinal studies need to link different data about a specific subject, collected at different times for research and administration use. In this paper we present the security concept proposed for sesam, a longitudinal interdisciplinary study that analyses the social, biological and psychological risk factors for the development of psychological diseases. Our security concept is based on pseudonymisation, encrypted data transfer and an electronic data custodianship. This paper is mainly a case study and some of the security problems emerged in the context of sesam may not occur in other studies. Nevertheless we believe that an adopted version of our approach could be used in other application scenarios as well.
Der ganze Artikel als .pdf am
Originalstandort oder
allenfalls auch hier.
Ein paar relevante Zitate aus dem 7seitigen Artikel:
Because of the need to link subjects and scientific data even anonymisation without quality reduction is not applicable for sesam. Considering these constraints, protecting the subject’s privacy is limited to pseudonymisation of scientific data and protecting the data and mapping between subjects and data from unauthorised access.
(...)
We use pseudonyms called subject identifiers or SIDs to identify the subjects about which scientific data was collected. All personal information like name or address is stored associated with another pseudonym called subject study number or SSN. The mapping between SID and SSN is not stored in sesamDB. We establish an electronic data custodian to control the access to the mapping between the SSNs and the SIDs.
The mapping information is stored in a second database located at an external location and administrated by an external organisation. This external database, called mapDB, is connected to sesamDB via a private connection. sesam-employees have no direct access to mapDB and can only access the mapping information using a sesam client application. These client applications authenticate users and restrict the access to the mapping information to specific use cases.
(...)
sesamDB will be backed up to a second server on a daily basis. This second server is placed in the same location with the sesamDB server. In addition tape backups will be performed every week and the tapes will be stored in a secured location outside the central site.
(...)
Access to data stored in the sesamDB is restricted to computers located at the sesam central site. These computers are connected to sesamDB via a local network connection. We require that no computer that is connected to sesamDB is connected to the Internet. The access to sesamDB is restricted to specialised client applications, which have only access to the data needed for their field of activity. For example the client application used for data export and scientific analysis has access rights for all scientific data, but no access rights for personal subject information and mapDB.
The client application used for data export logs all data export queries and stores the log information in sesamDB. The log information allows us to monitor the data exports and analyse the exports executed by a specific person. Data is made availible to third parties in aggregated form, without SIDs and with assent of the study direction.
patpatpat - 28. Okt, 12:46
Stefan Stöcklin berichtet heute in der baz über die Medienkonferenz der Uni Basel in Sachen Forschungsstrategie in den Life Sciences:
Die Universität will mehr klinische Forschung
Die Life-Sciences sind und bleiben Hauptschwerpunkt der universitären Forschung. Vermehrt wird nach Anwendungen gesucht.
«Wir sind sehr gut, aber wir sind nicht sehr viele», sagte Antonio Loprieno, der Rektor der Universität Basel, zum Zustand seiner Institution und verwies auf die eben veröffentlichten Rankings, wo Basel beispielsweise Platz 75 der besten Hochschulen weltweit erreicht hat. Loprieno und sein Vizerektor Forschung, Peter Meier-Abt, nahmen die BioValley-Life-Sciences-Woche im Kongresszentrum zum Anlass, um ihre Forschungsstrategie einem grösseren Publikum näher auszuführen.
Dass sie dazu das Biotech-Event auswählten, war natürlich kein Zufall, sondern inhaltliches Programm. «Die Lebens- und Kulturwissenschaften sind unsere beiden Makroschwerpunkte», sagte Loprieno. Beide würden gleichberechtigt nebeneinander stehen, doch alle wüssten, der eine › die Life Sciences › sei ein bisschen «gleicher».
Damit hob der Rektor die grosse Bedeutung der Lebenswissenschaften hervor, die in Basel richtigerweise gefördert würden. Da sie viel kosteten und die Universität nicht in der Lage sei, allein die notwendige kritische Masse zu erreichen, seien Kooperationen nötig. Loprieno erwähnte sowohl die Zusammenarbeit mit der grossen Wissenschaftsgemeinde der trinationalen Region als auch mit den Unternehmern.
Umsetzung in Praxis. Des Rektors Votum für die Life Sciences war ein willkommenes Zuspiel für den Vizerektor Forschung. Peter Meier-Abt nannte drei Pfeiler, die für eine «erfolgreiche Entwicklung» der Life Sciences wichtig seien: die Umsetzungsforschung (Translational Research), das heisst die Überführung von Erkenntnissen in anwendbare Produkte, die Zusammenarbeit mit industriellen Partnern und der Dialog mit der Öffentlichkeit.
Ins Zentrum seiner Ausführungen stellte Meier-Abt sodann die klinische Forschung, das heisst Untersuchungen und Forschungsarbeiten mit und an Menschen zur Entwicklung von medizinischen Wirkstoffen. «Die klinische Forschung muss eine unserer Stärken werden», postulierte Meier-Abt. Dies durch eine Bündelung der Kräfte, von der Grundlagenforschung bis zum Versuch in der Klinik. «Es geht nicht darum, die Grundlagenforschung zu beschneiden, sondern wenn immer möglich Anwendungen zu generieren», sagte Meier-Abt im Gespräch mit der baz.
Neben den Pharmawissenschaften zählt er im Weiteren auf die Systembiologie am Zentrum der ETH in Basel und an der Universität.
Interessant schliesslich die Rolle, die der Forschungs-Vizerektor dem umstrittenen Nationalen Forschungsschwerpunkt «sesam» beimisst, das heisst der grossangelegten Kinderstudie zur Erforschung von Depressionen. Als Projekt der Psychologie stehe «sesam» an der Schnittstelle zwischen den beiden Makroschwerpunkten. Das von der Ethikkomission noch nicht bewilligte Projekt solle in Zukunft dazu dienen, eine Brücke zwischen den beiden zu schlagen. Denn auf Dauer sei die Trennung unzeitgemäss.
Da speziell Forschung mit Menschen Anlass zu kontroversen Diskussionen gibt, müsse der Dialog mit der Öffentlichkeit gepflegt werden. Hier macht die Universität vorwärts: Ab nächstem Jahr soll im Pharmazeutischen Museum am Totengässlein ein «Café Scientifique» eröffnet werden, wo offene Fragen diskutiert würden.
patpatpat - 18. Okt, 12:59
Am 12.10. schreibt Kathrin Keller-Schuhmacher, Co-Leiterin F-NETZNordwestschweiz, im baz-Forum (Plattforum für Gastbeiträge der Printausgabe):
Das NF-Projekt «sesam» wird im Internet gut dargestellt. Mit der Vorstellung von hochkarätigen Mitarbeitenden werden Zweifel an der Verhältnismässigkeit der zur Verfügung stehenden 22 Mio. behoben. Was sich der Laie unter Wissenschaft vorstellt, liegt gefällig vor ihm ausgebreitet. Forschungsergebnisse zum gesunden Werden des Menschen in seinen ersten Lebensjahren beschäftigen neben Fachpersonen aus Beratung und Therapie auch jene an der Basis, die Begleitung anbieten. Ohne Vorliegen eines definierten Problems tragen sie dazu bei, dass Kindern ein würdiges Aufwachsen, eine gelingende Entwicklung möglich wird. Es gibt Erkenntnisse aus der Hirn-, Säuglings-, Kleinkind- und Sozialforschung, deren Umsetzung im Hier und Jetzt erfolgen müsste und nicht erst, wenn «das Kind in den Brunnen gefallen ist». Dazu fehlt Geld. Davon ist in «sesam» keine Rede.
Könnte das Bild des Elfenbeinturms der Wissenschaft erklären, weshalb bei der Vorstellung des Projektes nirgendwo auf diese schon längst bestehende Alltagspraxis Bezug genommen wird? Fachpersonen, die sich im Frühbereich engagieren, wissen, dass Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, die ersten Lebensjahre eines Kindes von natürlichen Krisen begleitet werden und es sich dabei um eine äusserst sensible Lebensphase in der Entwicklung des Mutter-/Vaterseins handelt.
F-NETZNordwestschweiz kann sich nicht vorstellen, wie sich Familien 20 Jahre für unterschiedliche Untersuchungen zur Verfügung halten, ohne von einem von Anfang an sorgfältig aufgebauten und über die Jahre tragenden Vertrauens- und Beziehungsnetz begleitet zu werden. Was geschieht, wenn Studierende bei ihren Kontakten und Befragungen bei werdenden und gewordenen Müttern und Vätern, bei Neugeborenen und Kleinkindern, gleich zu Beginn Gefährdungen feststellen? Heisst es dann: Augen zu und weiter forschen? Und später: Klar, dass es schief kommen musste! Die im Frühbereich begleitenden Angebote entziehen sich dem Trend, schon die frühe Kindheit unter der Lupe von Abweichungen und Störungen zu betrachten. Pädagogisch-sozial orientierte Begleitung erfordert Vermittlung von salutogenetisch orientierten Handlungsstrategien, die aus wissenschaftlichen Erkenntnissen erarbeitet sind. F-NETZNordwestschweiz hat miterlebt, wie weit Vorstellungen und Fragestellungen aus salutogenetisch orientierter Praxis und das Vorgehen bei «sesam» auseinanderklaffen können. Selbst bei gegenseitiger Wertschätzung begegneten sich Welten. Müssten jene, die forschen und jene, die die gewonnenen Erkenntnisse im Alltag umsetzen, sich nicht ab Beginn eines Projektes an einen gemeinsamen Tisch setzen? Im Zeitalter des Dialoges und von Teamarbeit sollte es dazu Wege geben.
patpatpat - 14. Okt, 10:45
Die "
Chronik" von Sesam besagt:
Okt 2006 vorgesehener Termin für die erste Zwischenbegutachtung (Site Visit) durch das internationale Gutachtergremium des Schweizerischen Nationalfonds (SNF).
Herbst 2006 Vorgesehener Termin für Vorstudien.
April 2007 Vorgesehener Termin für den Beginn der sesam-Hauptstudie.
Beim Züricher Informatiker Boris Glavic, federführend in Sachen Software für Sesam,
steht auf der Website zu lesen:
Semester- und Diplomarbeiten
Im Rahmen des sesamDB Projektes sind aktuell einige Dimplomarbeiten aus dem Bereich Implementierung von Java Anwendungen mit Datenbankzugriff zu vergeben. Bei Interesse einfach per Mail, Telefon oder in meinem Büro melden.
Thema: Entwurf und Implementierung einer modular erweiterbaren Anwendung für Eingabe und Import von heterogene Daten
Um die heterogenen wissenschaftlichen Daten von sesam in sesamDB zu speichern wird eine Anwendung benötigt, die einem Benutzer die Eingabe oder den Import dieser Daten ermöglicht. In dieser Diplomarbeit soll ein Konzeptes für eine flexibel erweiterbare Anwendung für Dateneingabe und -import erstellt und umgesetzt werden. Diese Anwendung soll in Java implementiert werden.
Thema: Entwurf und Implementierung einer modular erweiterbaren Anwendung für die Erhebung von Daten innerhalb der sesam Studie
Für die Datenerhebung von sesam wird eine Anwendung benötigt, die den an der Datenerhebung beteiligten sesam Mitarbeitern die Eingabe von Informationen über Datenerhebungen in einem standardisierten und zum Schema von sesamDB konformen Format ermöglicht. In dieser Diplomarbeit soll ein Konzeptes für eine Anwendung für die Eingabe von Informationen über Datenerhebungen erstellt und umgesetzt werden. Diese Anwendung soll in Java implementiert werden.
Thema: Entwurf und Implementierung einer Datenbank-Clientanwendung zur Eingabe, Modifikation, Darstellung und Export von bitemporalen Personendaten
Für die Verwaltung von Terminen und persönlicher Daten der Teilnehmer der sesam Studie wird eine Clientanwendung benötigt. Diese Clientanwendung soll einem sesam Mitarbeiter ermöglichen neue Probanden in der Datenbank zu speichern, €nderungen an vorhandenen Probandendaten vorzunehmen, Termine mit Probanden zu vereinbaren und Probandendaten zu exportieren. In dieser Diplomarbeit soll ein Konzeptes für diese Anwendung entwickelt und umgesetzt werden. Diese Anwendung soll in Java implementiert werden.
Thema: Entwurf und Implementierung einer Datenbank-Clientanwendung für den Export von Daten für statistische Analysen
Die von sesam erhobenen Daten werden mit Hilfe von Statistiksoftwarepaketen wie SPSS oder STATA analysiert. Er wird eine Anwendung benötigt, um von sesam erhobene Daten in Datenformaten zu exportieren, die von weit verbreiteten Statistikprogrammen unterstützt werden. Diese Anwendung soll ebenfalls eingesetzt werden, um Daten zu exportieren, die von der sesam-Zentrale an andere Studienorte verschickt werden. Aus Sicherheitsgründen müssen diese Daten bei dem Export pseudonymisiert werden. In dieser Diplomarbeit soll ein Konzeptes für diese Anwendung entwickelt und umgesetzt werden. Diese Anwendung soll in Java implementiert werden.
Wenn diese Seite nicht bereits hoffnungslos veraltet ist, weil die Arbeiten längst vergeben sind, dann klingt das sehr danach, als ob für Entwurf und Programmierung von zentralen Bausteinen zur Datenverwaltung von Sesam erst noch DiplomandInnen gefunden werden müssen. Was bedeutet das für den Termin April 07, wenn die Hauptstudie (siehe oben) beginnen soll? Denn dann müssen wohl die Arbeitsinstrumente, auch für den Umgang mit den Datenbanken, vorhanden sein und fehlerfrei funktionieren... Was erklärt wohl die Sesamleitung diesbzüglich dem "internationalen Gutachtergremium des Schweizerischen Nationalfonds (SNF)", dessen Besuch für diesen Monat angekündigt ist in der Chronik?
patpatpat - 8. Okt, 10:41
Vier Basler Grossrätinnen haben in einem Brief an die EKBB, Ethikkommission beider Basel, darum gebeten, dass den Familien, die zur Teilnahme an der Studie eingeladen werden, auch die kritischen Ueberlegungen zugänglich gemacht werden müssen, um einen „informed consent“ zu ermöglichen.
Die Gesundheitskommission der SP BS hat sich über SESAM informieren lassen.
Die regionale Kommission „Kirche und Wirtschaft im Gespräch“ hat sich im Juni durch Herrn Margraf über SESAM orientieren lassen und entschieden, dass sie auch die kritischen Fragen kennen lernen möchte.
An einer Tagung der SAGW, Schweiz. Akademie der Geisteswissenschaften, wurde SESAM vorgestellt. Carola Meier-Seethaler hat bei der Gelgeneheit den kritischen Standpunkt vertreten.
Die Anfrage einer Juristin, die beim Nationalfonds um Einsicht in die Projektunterlagen bat (gestützt auf das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung), wurde abgelehnt.patpatpat - 20. Sep, 12:12
Stefan Stöcklin heute in der baz über juristische Abklärungen, die das Projekt bremsen:
Seit einigen Monaten wartet die Ethikkommission beider Basel auf die Eingabe des Forschungsprojektes «sesam». Wann und wie es weitergehen soll, ist nach wie vor offen.
Eigentlich planten die Studienleiter um den Basler Psychologen Jürgen Margraf, ihre Gesuche für den grossangelegten Nationalen Forschungsschwerpunkt «sesam» noch im Frühling 2006 der Ethikkommission beider Basel (EKBB) zur Begutachtung vorzulegen. Deren Zustimmung ist nötig, damit die Versuche starten können.
Bis Ende Jahr sollten die ersten Studien mit schwangeren Frauen anlaufen. So zumindest lautete der provisorische Plan, den die Projektleitung an einer Medienkonferenz der Öffentlichkeit Anfang Jahr vorlegte. Doch davon ist keine Rede mehr. «Wir legen uns im Moment nicht mehr auf einen Termin fest», sagt Mediensprecherin Barbara Glättli.
Zwar haben die «sesam»-Forscher am 12. Juni erste sogenannte «Vorstudien» bei der Ethikkommission eingereicht, aber diese reichen zur Beurteilung nicht. «Wir können die Vorstudien nicht isoliert beurteilen», sagt Hans Kummer, emeritierter Professor für Medizin und Präsident der EKBB. «Wir müssen wissen, was auf die Leute zukommt und brauchen dazu auch die Details der Kernstudie.»
In den Vorstudien sollen Methoden und Verfahren des Projektes, zum Beispiel Fragebögen oder Untersuchungen, an nicht schwangeren Versuchspersonen getestet werden. Bei der Kernstudie handelt es sich um die 3000 Kinder, die ab der 12. Schwangerschaftswoche untersucht und bis zum 20. Altersjahr begleitet werden sollen.
Damit ist im Moment völlig offen, wann der EKBB-Entscheid vorliegen wird und wann es mit den Studien losgeht. Unklar ist zudem auch, ob die Ethikkommission die Studien in der geplanten Form gutheissen oder ob sie Auflagen machen wird. Gut möglich ist, dass noch ausstehende Expertengutachten eingeholt werden müssen. Dabei geht der Geldgeber, der Schweizerische Nationalfonds, immer noch davon aus, dass das Projekt im vorgesehenen Rahmen durchgeführt werden könne, wie Sprecher Alan Knaus sagt.
Zu den Verzögerungen sei es gekommen, weil die Detailabklärungen viel mehr Zeit kosteten als geplant. Alexander Grob, Professor für Entwicklungspsychologie an der Universität Basel und stellvertretender Direktor von «sesam», sagt: «Es handelt sich um ein komplexes Projekt, das in dieser Form noch nie durchgeführt wurde und ausserordentliche Abklärungen nötig macht.» Andere von der baz befragte und unabhängige Personen sind der Meinung, dass die Projektverantwortlichen die ethische Brisanz und juristische Komplexität massiv unterschätzt hätten.
Güterabwägung. Sicher ist, dass sich «sesam» in einem ethisch und juristisch heiklen Feld bewegt. Problematisch ist die Forschung an urteilsunfähigen Kindern, die den Betroffenen keinen Nutzen bringt (fremdnützige Forschung). Experten kommen in grundsätzlichen Überlegungen zu ganz unterschiedlichen Schlüssen, inwieweit diese Forschung zulässig ist, wie zwei Beiträge in der NZZ (12.8.2006 [siehe sesam watch
hier und
hier]) kürzlich deutlich machten.
Im Zentrum steht die Frage, ob die Menschenwürde der Kinder durch die Untersuchungen tangiert ist oder nicht. Dies wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn ihre Freiheit zur Entwicklung in irgend einer Form eingeschränkt würde. Demgegenüber steht der Erkenntnisgewinn der Studie, der anderen Kindern zugute kommen könnte. Hier ist eine Abwägung vonnöten, die je nach Standpunkt unterschiedlich ausfallen kann.
Es wird an der EKBB liegen, das Gebot der Menschenwürde zu prüfen, was aufgrund der langfristig angelegten Studie, die über 20 Jahre dauert, ein schwieriges Unterfangen sein wird. Juristische Hürden ergeben sich im Weiteren im Bereich des Datenschutzes und weil das Vorhaben an der Schnittstelle Medizin/Psychologie operiert. «Auch hier betreten wir Neuland», sagt Alexander Grob. «Wir müssen Pionierarbeit leisten.»
Für «sesam» erschwerend kommt hinzu, dass im Moment ein Bundesgesetz über die Forschung am Menschen am Entstehen ist. Bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes wird es noch Jahre dauern und «sesam» dient nun als Modell- oder Spielfall, was alles bedacht werden kann. Bis zum Bundesgesetz ist kantonales Recht gültig und das erleichtert die Dinge nicht.
Kantonal unterschiedlich. Denn weil es sich bei «sesam» um eine Multizenterstudie handelt, an der verschiedene Kantone mit zum Teil unterschiedlichen Gesetzen beteiligt sind, ist die Rechtslage unübersichtlich. Die Projektleitung von «sesam» hat dazu eine «Einschätzung» beim St. Galler Juristen Rainer J. Schweizer in Auftrag gegeben. Diese Würdigung ist noch nicht abgeschlossen und unter Verschluss.
Spielraum. Alexander Grob macht aber deutlich, dass darin die kantonalen Gesetze verglichen und in ihrer Wirksamkeit auf «sesam» untersucht werden. «Wir wollen uns absichern, dass wir korrekt vorgehen», so Grob zur baz. Beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), das in die juristischen Diskussionen einbezogen wurde und Kenntnis von dieser Arbeit hat, heisst es: «Das Gutachten kommt zum Schluss, dass einige der Fragestellungen gesetzlich nicht eindeutig geklärt sind», erläutert Michael Gerber vom BAG. Es gibt also offensichtlich Spielraum › auch bezüglich der Zuständigkeit der EKBB.
Bei «sesam» will man sich nicht detailliert zu Schweizers Einschätzungen äussern. Das Gutachten Schweizers diene aber nicht dazu, die Kompetenz der EKBB in Frage zu stellen. Oder negative Entscheide anzufechten. «Wir wollen, dass die EKBB über ‹sesam› entscheidet. Und wir werden den Entscheid akzeptieren», sagt Alexander Grob. Die EKBB wird ihren Entscheid öffentlich bekannt geben.
patpatpat - 26. Aug, 15:42
12. August 2006, Neue Zürcher Zeitung, Giovanni Maio, Inhaber des Lehrstuhls für Bioethik und Geschäftsführender Direktor des Interdisziplinären Ethik-Zentrums an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Deutschland, über "Das Kind als Forschungsobjekt":
Ethische Überlegungen zur fremdnützigen Forschung mit Kindern
Ethische Konzepte, die für die Erwachsenen entworfen wurden, können nicht ohne weiteres auf Kinder übertragen werden. Kinder dürften insbesondere nicht «atomistisch», sondern sie müssen im Verbund mit ihrem sozialen Umfeld betrachtet werden, so der Ethiker Giovanni Maio. Daher liege es in erster Linie an den Eltern, das Kindswohl zu definieren und so über eine allfällige fremdnützige Forschung an ihren Kindern zu urteilen.
Die Forschung an Kindern gehört zu den besonders umstrittenen Themenbereichen der medizinischen Ethik, weil sich in diesem Problemfeld zwei entscheidende Entwicklungen kreuzen, die unvereinbar scheinen. Wir haben auf der einen Seite eine zunehmende Sensibilität für die Rechte der Kinder zu verzeichnen; auf der anderen Seite erfordern der medizinische Fortschritt und die Medikamentensicherheit es immer mehr, dass auch Kinder in klinische Studien einbezogen werden. Dass man in einer solchen Zeit, in der die Rechte der Kinder so gestärkt werden, Vorschläge unterbreitet, Kinder nicht nur ärztlich zu behandeln, sondern sie auch zu Forschungszwecken zu benutzen, erscheint zunächst befremdlich, erst recht in den Fällen, in denen von vornherein klar wäre, dass das Kind von der Forschung gar keinen eigenen Nutzen hätte, wenn also das Kind zu rein fremdnützigen Forschungen herangezogen werden würde. Widersinnig erscheint die Forderung nach fremdnütziger Forschung an Kindern deswegen, weil gerade Kinder vulnerable Wesen sind, Menschen, die sich nicht wehren können, die potenziell ausgeliefert sind und die ausgenutzt werden können.
Wie weit geht die Pflicht zur Hilfe?
Hinzu kommt, dass der Mensch als Forschungsobjekt in den Dienst des Erkenntniszuwachses gestellt wird, er wird zu einem subjektfremden Zweck benutzt. Die Instrumentalisierung des Menschen kann zwar durch die freie Einwilligung gerechtfertigt werden, indem der Mensch mit der Einwilligung den subjektfremden Zweck zu seinem eigenen Zweck macht. Kinder jedoch sind bis zu einem bestimmten Reifegrad keine vollständig autonomiefähigen Menschen; sie können nicht bindend einwilligen. Daher stösst die Forschung mit Kindern auf gravierende ethische Probleme. Ist es vor diesem Hintergrund überhaupt denkbar, fremdnützige Forschung an Kindern als eine moralische Handlung zu betrachten?
In der Diskussion um die Legitimität der Forschung mit Kindern wird oft das Argument ins Feld geführt, dass man eine Hilfspflicht zukünftigen Kindern gegenüber habe und dass schon von daher eine Verpflichtung zur Forschung bestehe. Wenn man nämlich die fremdnützige Forschung mit Kindern für unmoralisch erklärte - so die Argumentation -, dann müsste man in Kauf nehmen, dass Kinder Medikamente erhalten, die nur an Erwachsenen, nicht aber an Kindern erprobt worden sind. Denn für die Unbedenklichkeits- und Wirksamkeitsprüfung von Arzneimitteln ist eine Testung dieser neuen Medikamente auch an Kindern notwendig, die keinerlei Vorteil von einer solchen Testung hätten. Angesichts dessen, dass ein Grossteil der Medikamente, die heute in der Kinder- und Jugendmedizin verabreicht werden, streng genommen für Kinder gar nicht zugelassen sind, müsste - nach dieser Argumentation - allein im Interesse des Patientenkollektivs «Kinder» die Forschung an Kindern erlaubt werden. Dieser Hinweis hat vieles für sich, denn gerade den Arzt kann diese Hilfspflicht für zukünftige Kinder nicht unbekümmert lassen, stellt doch auch die medizinische Forschung einen mittelbaren Dienst am kranken Menschen dar.
Doch das ethische Problem wird dann schwieriger, wenn wir es mit einer eindeutig nichttherapeutischen Studie zu tun haben, wenn also das Kind selbst keinerlei therapeutischen Vorteil aus der Studienteilnahme hätte. Bei einer solchen fremdnützigen Forschung stellt sich der moralische Konflikt in der Weise dar, dass dem jetzigen Kind eine Studie zugemutet werden muss, die erst zukünftigen Kindern zugute kommen soll. Wenn man den Wertkonflikt dieser Frage genauer analysiert, so liesse sich dieser formulieren als Konflikt zwischen zwei konkurrierenden Verpflichtungen; auf der einen Seite die negative Verpflichtung zur Vermeidung einer unmittelbaren Instrumentalisierung des Kindes, auf der anderen Seite die positive Verpflichtung zur mittelbaren Hilfeleistung für zukünftige kranke Kinder.
Philosophisch gesehen stehen diese zwei Verpflichtungen in einer lexikalischen Ordnung zueinander, und zwar in der Weise, dass die unmittelbare negative Verpflichtung Vorrang vor der mittelbaren positiven Verpflichtung hat. Dies erklärt sich daraus, dass negative Verpflichtungen vollkommene Pflichten darstellen, d. h., ihre Befolgung unterliegt einer unbedingten Notwendigkeit. Die Hilfspflicht hingegen kann lediglich den Status der unvollkommenen Pflicht beanspruchen, was impliziert, dass ihre Befolgung von den Umständen der Entscheidungssituation abhängt. Dadurch, dass der Unterlassung von Schaden die Anerkennung fremder Rechte zugrunde liegt, stellt diese Unterlassung eine dringlichere Pflicht dar, so dass das positive Gebot des Helfens dort eine Grenze erfährt, wo zur Hilfe die «Schädigung» Dritter notwendig ist.
Wenn man also so argumentieren wollte, dass man eine Hilfspflicht zukünftigen Kindern gegenüber hätte, so würde man die beschriebene lexikalische Ordnung umkehren und die positive Hilfspflicht für relevanter ansehen als die negative Unterlassungspflicht, keinem Menschen einen Schaden zuzufügen. Dies bedeutete nichts anderes, als dass wir es für gerechtfertigt halten würden, jetzigen Kindern ein Opfer dafür abzuverlangen, damit zukünftigen Menschen geholfen werde. So sehr es auch wünschenswert wäre, dass zukünftige Kinder unbedenkliche Medikamente bekämen, es ist nicht die Grösse des zu erwartenden Drittnutzens, die eine Aussage über die Legitimität der Fremdverzweckung erlaubt. Würden wir die Hilfe für Dritte tatsächlich als Rechtfertigungsgrund nehmen, so müssten wir in Fällen, in denen diese Hilfe ein Höchstmass erreichte, bereit sein, auch ein Höchstmass an «Opfer» zu verlangen. Eine solche Argumentation ist nicht haltbar, weil man damit die grundsätzlich unveräusserlichen Grundrechte eines Menschen gegen Interessen Dritter abwägbar machte. Die dringende Angewiesenheit anderer Patienten auf die Durchführung solcher Studien zu deren Legitimation kann allein noch nicht ausreichen.
Das Kindsein ernst nehmen
Das ethische Problem der fremdnützigen Forschung mit Kindern lässt sich nicht durch den Verweis auf die positiven Folgen der Forschung lösen. Die entscheidende Frage lautet nicht, ob sich Rechtfertigungsgründe für die Verzweckung der Kinder finden lassen. Vielmehr hängt alles von der Frage ab, ob es sich bei der Forschung mit Kindern tatsächlich um eine illegitime und rechtfertigungsbedürftige Verzweckung handelt. Wir hatten bereits festgehalten, dass die Illegitimität durch die Einwilligung aufgehoben werden kann. Da Kinder nicht einwilligen können, ist diese Aufhebung direkt nicht möglich. In der bisherigen Diskussion wird die fehlende Einwilligungsfähigkeit der Kinder zum Ausgangspunkt der Kritik gemacht und damit oft stillschweigend vorausgesetzt, dass deswegen jede drittnützige Teilnahme von Kindern an Forschungsvorhaben grundsätzlich unmoralisch sei.
Eine solche Annahme lässt sich jedoch nicht in dieser kategorischen Weise halten, weil mit dieser Annahme vorausgesetzt wird, dass die Legitimitätsbedingungen, die für Erwachsene gelten, automatisch auch für Kinder gelten müssen. Genau diese Voraussetzung ist jedoch eindeutig falsch, weil ethische Konzepte, die für die Erwachsenenmedizin entwickelt wurden, nicht unhinterfragt auf Kinder übertragen werden können. Um dem Kind tatsächlich gerecht zu werden, dürfen Kinder nicht als kleine Erwachsene betrachtet werden, sondern als Wesen, die in ihrem Kindsein respektiert werden müssen. Das bedeutet, dass das Kindsein für sich genommen einen Eigenwert hat, der eigenständige Ethikkonzepte notwendig macht. Daher ist es zur Klärung des ethischen Problems der Forschung mit Kindern notwendig, eine kindorientierte Ethik als Grundlage zu nehmen und nicht eine Ethik, die wir sonst im Umgang mit Erwachsenen bemühen.
Grundlagen einer kindorientierten Ethik
Der Schwerpunkt einer kindorientierten Medizinethik müsste darin liegen, das Kind nicht vornehmlich als Freiheitsträger zu betrachten, sondern es vor allem als Interessensträger zu sehen, als ein Mensch, der in gleicher Weise als in sich wertvolles Wesen geachtet und damit in seinen Interessen - die nicht nur Freiheitsinteressen sind - geschützt werden muss. Die ethische Frage lautet also nicht: «Wie kann beim Kind der ‹informed consent› ersetzt werden?». Die zentrale ethische Frage im Umgang mit Kindern müsste daher vielmehr lauten: «Wie kann dem Kind als Kind die notwendige Achtung als selbstgesetzliches Wesen entgegengebracht werden?»
Diese entscheidende Achtung des Kindes lässt sich nicht zuletzt durch die Sorge um das Wohl des Kindes, durch die Anerkennung des Kindes als eine unverwechselbare und einzigartig wertvolle und zugleich unverfügbare Person realisieren. Vor diesem Hintergrund verlagert sich der Blickpunkt ethischen Argumentierens vor allem auf die Definierbarkeit des Kindeswohls. Um das Wohl des Kindes in ethischer Hinsicht definieren zu können, muss nach den spezifischen Merkmalen des Kindseins gefragt werden. Was ist für das Kind spezifisch? Ein besonderes Spezifikum des Kindes ist (1) seine Ausrichtung auf Entwicklung. Daher ist der Schutz der Entwicklungsfähigkeit des Kindes sicher eine zentrale Grundlage für die Definierung des Kindeswohls. Damit verknüpft ist (2) die Verpflichtung, dem Kind die grösstmöglichen Chancen für die Zukunft zu gewähren. Der Philosoph Joel Feinberg spricht in Bezug auf eine kindorientierte Ethik vom «Recht des Kindes auf eine offene Zukunft».
Drittens ist das Kind wie kein anderes Wesen durch seine besondere Vulnerabilität charakterisiert. Das Kind ist verletzlich, weil es manipulierbar, verführbar und auch ausnutzbar ist. Schliesslich ist (4) das Kind auf sein soziales Umfeld angewiesen wie kein anderes Wesen. Das Spezifische des Kindseins ist das Angewiesensein auf Beziehungen, das Angewiesensein auf ein Gegenüber, auf ein intaktes Beziehungsumfeld.
Nach diesen Kriterien einer kindorientierten Ethik liegt es auf der Hand, dass - ganz gleich, von welchem Drittnutzen man ausgeht - eine Studie an Kindern nie gerechtfertigt sein kann, wenn sie mit dem Schutz der Entwicklungsfähigkeit kollidiert oder wenn ersichtlich wäre, dass die besondere Wehrlosigkeit und Manipulierbarkeit von Kindern ausgenutzt werden würde. Im Hinblick auf die Entwicklungsfähigkeit und das Recht auf eine offene Zukunft müssen Studien ausgeschlossen bleiben, von denen ein höheres Risiko ausgeht oder die möglicherweise traumatisierend für Kinder sind, da auch das Trauma die Zukunft des Kindes behindern kann. Was die besondere Vulnerabilität der Kinder angeht, so müsste gewährleistet sein, dass nur diejenigen Studien mit Kindern vorgenommen werden, die an den weniger vulnerablen Erwachsenen grundsätzlich nicht durchgeführt werden können. Eine Gewähr des Schutzes dieser Vulnerabilität kann in der Regel letztlich nur über den Einbezug der Eltern gewährleistet werden. Daher ist der Aspekt der Vulnerabilität eng mit dem Hinweis auf das Angewiesensein auf Beziehungen verknüpft. Die Achtung des Kindes als vulnerables Wesen kann vor allem dadurch gewahrt werden, dass das Kind in seinem sozialen Gefüge wahrgenommen und das Umfeld des Kindes als Teil seiner eigenen Identität und seines Wohlergehens betrachtet wird. Die Achtung realisiert sich dadurch, dass danach gefragt wird, wie man seinem Wohl in diesem Gefüge gerecht werden kann. Weil das soziale Gefüge des Kindes in der Regel die Eltern sind, kommt diesen eine entscheidende Rolle zu. Hieraus wird deutlich, dass der beste Schutz der Kinder demnach die Wahrung der Integrität der Eltern-Kind-Beziehung wäre.
Auf Beziehungen angewiesen
Genau hierin liegt der Schwachpunkt der bisherigen Diskussion um die Legitimität der Forschung an Kindern. Kinder wurden atomistisch betrachtet, als Einzelwesen, die aufgrund ihrer Vulnerabilität vom Staat über das kategorische Verbot von Forschung an Kindern geschützt werden müssten. Eine solche Konzeption ist problematisch, weil Kinder sich nur in ihrem sozialen Umfeld entwickeln können. Der beste Garant für das Wohl der Kinder ist daher nicht der Staat, sondern sind in den allermeisten Fällen die Eltern. Eltern haben in allen anderen Lebensbereichen mit gutem Grund eine weitreichende Definitionshoheit über das Wohl ihrer Kinder. Wenn die fremdnützige Forschung mit Kindern verboten wäre, würde dies bedeuten, dass der Staat den Eltern eine adäquate Vertretung der Kindesinteressen im Kontext der Forschung nicht zutraut.
Würde es sich bei solchen Studien tatsächlich um Hochrisikostudien handeln, wäre dies noch eher nachvollziehbar, doch solange z. B. das minimale Risiko als eine fixierte Grenze formal vorgegeben ist, erschiene ein solcher Paternalismus nicht überzeugend. Er würde nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern bevormunden und würde ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Das kategorische Verbot fremdnütziger Forschung mit Kindern könnte so einen illegitimen staatlichen Paternalismus darstellen.
Wir waren von der Frage ausgegangen, wie die Achtung des Kindes realisiert werden kann. Allein dadurch, dass der Arzt die Eltern des Kindes vor jeder Behandlung oder Forschung fragt, bringt er zum Ausdruck, dass er die Selbstzwecklichkeit des Kindes respektiert und nicht einfach willkürlich an ihm handelt. Allein über das Fragen respektiert der Arzt das Kind als wertvolles und einmaliges Wesen, über das nicht frei verfügt werden darf. Das Fragen der Eltern stellt sicher, dass sich der Arzt der besonderen Situation des Kindseins vergewissert und sich eben nicht die Wehrlosigkeit der Kinder zunutze macht.
So lässt sich schlussfolgern, dass die erste Intuition, die fremdnützige Forschung an Kindern grundsätzlich für problematisch anzusehen, in dieser Radikalität nicht wohlbegründet erscheint. Es gibt gewichtige Argumente gegen eine solche Intuition. Allerdings sind diese Argumente nur so stichhaltig, wie man sich darauf verlassen kann, dass die Eltern tatsächlich «gut» für das Kind entscheiden. Daher muss Sorge dafür getragen werden, dass die Eltern selbst nicht dazu «verführt» werden, die Interessen ihrer Kinder aufs Spiel zu setzen. So wäre es beispielsweise problematisch, wenn die Eltern grosse finanzielle Anreize erhielten, Studien zuzustimmen. Ferner kann eine solche Beruhigung nur dann sich einstellen, wenn gerade von Seiten der Medizin anerkannt wird, dass es zwar eine Forschungsfreiheit gibt, aber keine Freiheit zur Forschung mit Menschen. Daher gibt es auch keine Verpflichtung der Menschen zur Teilnahme an Forschung. Eine Zwangssolidarität gerade von Kindern kann von Seiten der Medizin oder der Gesellschaft in keiner Weise postuliert werden.
Wenn alle forschenden Ärzte dies im Blick haben und es dem tatsächlich freien Entscheidungswillen der Eltern ohne moralische Appelle oder moralischen Druck überlassen, dann sind die Kinder in den Händen der Eltern sicher gut aufgehoben. Noch besser aufgehoben wären sie jedoch, wenn die Eltern darauf vertrauen könnten, dass ein Arzt als Arzt allein aufgrund der moralischen Integrität der Medizin seine Patienten nie im Interesse der Forschung «verraten» würde. Daher ist der Schutz der Kinder, ganz gleich, welche Gesetze gelten, nur so gut wie die Moralität der Ärzte. Wenn der Staat erwägt, bestimmte Studien an Kindern kategorisch zu verbieten, so ist das ein Armutszeugnis für das Vertrauen der Gesellschaft in die Moralität der Ärzteschaft. Hier besteht wohl der grösste Nachholbedarf für die Medizin der Zukunft.
patpatpat - 13. Aug, 11:03