Tagung am CHUV zu Forschung am Menschen
(via TA-Swiss) Recherche impliquant des êtres humains, Vendredi 17 février 2006, 13h30 – 17h00, Auditoire César-Roux du CHUV Lausanne, Programm als .pdf.
patpatpat - 29. Jan, 18:27
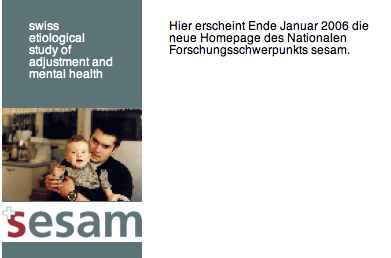
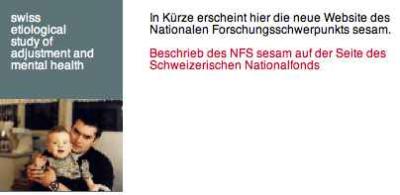
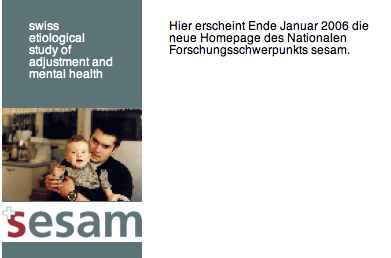
| Mit einer langfristig und ganzheitlich angelegten Untersuchung will der NFS Sesam (Swiss Etiological Study ofAdjustment and Mental Health) die Wege ergründen, die zu psychischer Gesundheit oder Krankheit führen.Die interdisziplinäre Ursachenforschung stellt Kinder und Familien in den Mittelpunkt. Im Rahmen einer Langzeitstudie untersucht Sesam die persönliche psychische Entwicklung von 3000 Personen von der zwölften Schwangerschaftswoche bis in das junge Erwachsenenalter unter Einbezug ihrer Eltern und Grosseltern. So entsteht nach und nach ein aufschlussreiches Bild des komplexen Zusammenspiels von psychischen, sozialen und biologischen Faktoren bei der Entwicklung von Gesundheit und Krankheit. Der NFS Sesam steht unter der Leitung des Psychologen Prof. Jürgen Margraf. Kooperationen bestehen im Rahmen eines Netzwerkes unter anderem mit den Universitäten Fribourg, Zürich, Bern und Trier. (Bildlegende: Der NFS Sesam soll dereinst im Hinterhaus des Instituts für Psychologie untergebracht werden – doch zuerst braucht es eine neue Lösung für die dort untergebrachten Juristen.) |