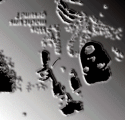BZ vom 11.3.06:
Den «grössten je im Bereich der Humangenetik abgeschlossenen Deal» kündigten im Februar 1998 die Biotechfirma DeCode, die Basler Pharmafirma Roche und Islands Ministerpräsident David Oddson an. Das von Roche in Aussicht gestellte Engagement von 200 Millionen Franken sollte Islands Parlament beflügeln, ein entsprechendes Gesetz für eine zentrale isländische Gesundheitsdatenbank zu unterzeichnen. DeCode wollte gratis eine umfassende Datenbank zur Planung des Gesundheitswesens liefern. Als Gegenleistung forderte die Firma Zugang zu staatlichen Gesundheitsdaten, die sie mit Gen-Daten der 290 000 Isländer ergänzen wollte, gewonnen aus Blutproben. Diese Daten und die öffentlich zugänglichen Familienstammbäume sollten DeCode Informationen über vererbbare Volkskrankheiten wie hoher Blutdruck oder Asthma liefern, um gezielt Medikamente zu entwickeln.
Nach einem weltweiten Echo ist es um das Projekt still geworden. Roche hat ihren Vertrag zwar mehrmals verlängert, aber sukzessive eingeschränkt, wie Klaus Lindpaintner, Leiter der Roche-Genforschung, präzisiert. Für die ambitiöse Gendatenbank hat DeCode, gemäss eigenen Angaben, nur einen Drittel der Bevölkerung, etwa 100 000 Isländer, gewinnen können. Die zentrale Gesundheitsdatenbank, der lukrative Deal für die Behörde, ist nie erstellt worden, sagt DeCode-Sprecher Edward Farmer gegenüber dieser Zeitung, ohne Gründe nennen zu wollen.
chr
patpatpat - 12. Mär, 10:51
Interview in der BZ vom 11.3.:
Das gescheiterte Genom-Datenprojekt über Islands Bevölkerung vergleicht die Philosophin Sigridur Thorgeirsdottir mit dem Dürrenmatt-Stück «Der Besuch der alten Dame».
Haben Sie Ihre Daten für Islands geplante Gesundheitsdatenbank zur Verfügung gestellt?
Sigridur Thorgeirsdottir: Nein, ich gehöre zu den 7 Prozent der Bevölkerung, die ausgestiegen sind. Weil ich das dazu gehörige Gesetz von 1998 nicht gut fand.
Warum nicht?
Das Gesetz ist fehlerhaft. Die Gesundheitsdaten sollten ohne schriftliche Einwilligung zur Verfügung gestellt werden. Der Staat ging von einer pauschalen mutmasslichen Einwilligung aus. Patienten, die damit nicht einverstanden waren, konnten ihre Daten ausschliessen lassen, so wie ich es getan habe. Es wurde offenbar befürchtet, zu viele Leute könnten ihre Unterschrift verweigern, falls sie explizit dazu angefragt würden.
Hat Islands Parlament zu diesem Gesetz keine Debatte geführt?
Das Gesetz war im Parlament sehr umstritten, ebenso bei den Ärzten und Forschern. Das Konzept der mutmasslichen Einwilligung ist moralischer Müll. Gerade weil auch eine kommerzielle Verwendung vorgesehen war, hätte man die Bürger auffordern sollen, der Freigabe ihrer Daten schriftlich zuzustimmen. Diese Einwilligung wäre wohl eher zu erhalten, wenn die Leute regelmässig über die Verwendung der Daten informiert würden und jederzeit ihre Daten zurückziehen könnten.
Zwei Drittel der 290 000 Isländer sagten nein. Sie trauen der Anonymisierung ihrer Daten offenbar nicht.
In einem so kleinen Land ist es tatsächlich schwierig, die Anonymität zu gewährleisten. Zwar gab es die Zusicherung, dass man keine Individuen in der Datenbank erkennen kann. Auf Grund von Informationen über Gruppen mit seltenen Krankheiten hätte man aber möglicherweise Schlüsse über bestimmte Leute ziehen können.
Was ist aus dem Scheitern von Islands Datenbank zu lernen?
Ein Gesetz für eine Gesundheitsdatenbank darf man nicht unter Zeitdruck verabschieden, wie dies geschehen ist. Dies hat zu einer hitzigen Debatte mit viel Kritik und Missverständnissen geführt. Es müssten alle Interessenvertreter für das Aushandeln einer Lösung gewonnen werden.
Dann würden die Leute eine Datenbank vielleicht akzeptieren?
Aber nur, wenn ein breites Wissen über Genetik und Pharmagenetik vorhanden ist. Dazu ist guter Wissenschaftsjournalismus unentbehrlich. In Islands Hauptstadt Reykjavik gab es während der Gesetzesdebatte viele Kulturjournalisten und Theaterkritiker, aber kaum kritische Wissenschaftsjournalisten. Was aber hat auf unser Leben mehr Einfluss, ein Theaterstück oder neue Forschungen und Tendenzen in den Biowisssenschaften? Es ist wichtig, dass wir uns fragen, was für Folgen die neue Technologie und Wissenschaft – hier eine mögliche Genetisierung der Gesundheitsvorsorge – haben könnte.
Sollte es weiterhin ein Recht auf Nichtwissen geben?
Darauf gibt es keine einfache Antwort. Dazu ein Beispiel. Es werden Diagnoseinstrumente entwickelt, die genetische Veranlagung für einen Herzinfarkt festzustellen. Stellt man diese Veranlagung bei einem zehnjährigen Mädchen fest, wird sie vielleicht künftig zum Medikamenten-Abonnenten. Und wächst im Wissen auf, potenziell herzkrank zu sein. Genetische Diagnosen können unser Selbstbild verändern. Es sollte nicht soweit kommen, dass dadurch andere Faktoren wie Ernährung oder Lebensstil unterbewertet werden.
Aber eine genetische Diagnose könnte doch zu individuell ab-gestimmten Medikamenten führen?
Man muss sich aber fragen, wie teuer solche Medikamente zu stehen kämen. Wird die staatliche Gesundheitsversorgung eine solche Entwicklung finanziell verkraften können? Und wird die genetische Ausrichtung der Medizin zudem die Gefahr der eingeschränkten Sicht auf Gesundheit und Krankheit mit sich bringen? Hoffentlich nicht.
Was ist Ihre Bilanz aus der Gesundheitsdatenbank-Affäre Ihres Landes?
Dass die Wirklichkeit manchmal dazu neigt, dem Stoff eines Dürrenmatt-Theaterstücks zu gleichen. Ich denke da an den «Besuch der alten Dame». Viele Leute, die sich als kritisch einschätzen, werden blauäugig, wenn Markt und wirtschaftlicher Gewinn im Spiel sind. Viele der Juristen und Ethiker, die sich mit Pro und Kontra von Biodatenbanken befassen, haben sich im Prinzip nicht den wirklich wichtigen Fragen gestellt. Es sind folgende Fragen: Welche Bedeutung haben solche Datenbanken für die Gesundheitsfürsorge, wie wird dabei unser Menschenbild und unsere Gesellschaft verändert?
Interview: Christian Bernhart
Sigridur Thorgeirsdottir ist Philosophin und Ethikerin in Islands Hauptstadt Reykjavik.
patpatpat - 12. Mär, 10:45
BZ, 11.3.:
Keine Angst: Genetische Daten sind in der Schweiz vor unbefugten Mitwissern geschützt durch das Gesetz! Ist das so? Leider nein. Das gültige Gen-Gesetz kann es nicht, alte Gesetze werden nicht eingehalten. Und das Arztgeheimnis ist in der Versicherungspraxis längst aufgeweicht. Bloss will das alles niemand wissen.
Es ist ein medizinischer Traum: Wissenschaftler möchten das Erbgut ganzer Völker auf Datenbanken ablegen und durchforsten, um so genetische Defekte zu finden, die womöglich die grossen Volkskrankheiten steuern. Die Pharmaindustrie träumt mit, in der Hoffnung, treffsicherere Medikamente mit weniger Nebenwirkungen zu entwickeln. Das lukrative Geschäft wäre eine angenehme Begleiterscheinung.
Zukunftsmusik? Nein. Das kleine Island startete 1998 das Projekt für eine nationale Gendatenbank (siehe Interview und Box). Die Schweizer Pharmaindustrie legt schon Biodatenbanken an. Und im letzten Oktober hat der Schweizerische Nationalfonds den Forschungsschwerpunkt «Sesam» gestartet. Von der Wiege bis zur Mündigkeit sollen 3000 Kinder mit Hilfe ihrer genetischen Daten und ihres familiären Umfelds Aufschluss über psychische Leiden geben. Das Projekt geniesst die Unterstützung von Novartis und Roche. Budget bis Ende 2009: 17 Millionen Franken.
Keine gesetzliche Basis
Die schönen Träume stossen aber auf Widerstand. In Island ist das optimistisch angekündigte Projekt vorerst gescheitert, weil zwei Drittel der Isländer ihre Gesundheitsdaten nicht für eine Gen-Datenbank preisgeben wollten. Die genetische Durchleuchtung des Menschen, vor ein paar Jahren noch euphorisch gefeiert, löst nun die Angst vor dem gläsernen Patienten aus, dessen versteckte Leiden für Staat, Medizin und Krankenkassen einsehbar werden – und missbraucht werden könnten. In der Schweiz lief unlängst der «Basler Appell gegen Gentechnologie» Sturm und forderte die Sistierung von «Sesam». Die grüne Nationalrätin Maya Graf doppelte in einer Interpellation nach, weniger radikal allerdings. Graf: «Ich will Wissen nicht stoppen, aber die Forschung kritisch begleiten und hinterfragen.»
Die Thematik würde eigentlich nicht nur gentechkritische Kreise betreffen. Sondern alle Bürgerinnen und Bürger. Es könnte sie insbesondere interessieren, dass die Verwendung genetischer Daten, wie sie in Schweizer Forschungsprojekten schon läuft, gesetzlich gar nicht, noch nicht oder nur unvollständig geregelt ist. Das bewilligte Bundesgesetz über die genetischen Untersuchungen beim Menschen (GUMG) tritt erst auf den 1. Januar 2007 in Kraft. Und für das übergeordnete «Gesetz über die Forschung am Menschen» ist Anfang Jahr erst die bis am 31. Mai andauernde Vernehmlassungsfrist angelaufen.
Das GUMG regelt Gen-Daten primär als Personenschutzgesetz. Es überlässt also dem Einzelnen den Entscheid, ob er sich über seine Gen-Daten ins Bild setzen will oder nicht – und überfordert ihn bald einmal. Inwiefern die ganze Gesellschaft vom Wissen über das Erbgut betroffen ist, das bleibt im Gesetz ausgeklammert. Eine allgemeine Debatte wird von Artikel 6 des Gesetzes gewissermassen verhindert: «Jede Person hat das Recht, die Kenntnisnahme von Informationen über ihr Erbgut zu verweigern.»
Nicht wissen geht nicht
Der Entscheid des Einzelnen ist aber nicht absolut. Wollen beispielsweise Paare vor einer Schwangerschaft wissen, ob in ihren Genen oder in jenen des Nachkömmlings mögliche Krankheiten stecken, dann muss sie der Arzt informieren, wenn der Gentest Hinweise gibt, dass sie unmittelbar selbst bedroht sind oder der Fötus im Mutterleib gefährdet ist. Wer sich also einem Gentest unterzieht, sei es aus Neugier oder für die Familienplanung, macht bereits den entscheidenden Schritt, nach dem es kein Zurück mehr gibt.
Auch der Stand von Forschung und Technik zwingt dem Einzelnen bald Kenntnisse über sein Erbgut auf, ob er das nun will oder nicht. Eine Gen-Diagnose ist in Kürze schnell und problemlos lieferbar. An der Universität Basel hat Christoph Gerber im Rahmen des Nationalen Forschungsschwerpunktes der Nanowissenschaften ein handliches Gerät entwickelt, das genetische Untersuchungen so schnell und einfach wie ein Blutgruppentest-Gerät durchführt. Der Gentest als Routineuntersuchungen dürfte in naher Zukunft kommen.
Wer an das verbriefte Recht auf Nichtwissen glaube, sei blauäugig, meint der Arzt und Informatiker Martin Denz, der als Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Informatik eingehend mit der Problematik medizinischer Daten vertraut ist. Wichtige Fragen stehen an: Was wird der Arzt als genetische Bedrohung einstufen, wenn er bei seiner Diagnose auf sicher gehen will, damit ihn später nicht der Vorwurf trifft, lebensrettende Informationen für sich behalten zu haben? Und wird der Patient auf Informationen verzichten wollen, verzichten können, wenn er weiss, dass es womöglich ein Hinweis auf eine Krankheit gibt?
Schon heute kann der Patient eigentlich gar nicht mehr nicht wissen wollen. Weil es immer mehr heikle Daten gibt. Damit ist für Denz eine Spirale angestossen: «Einmal bekannt gewordene Gesundheitsdaten lassen sich nicht ungeschehen oder rückgängig machen.»
Einblick für Versicherer
Dazu kommt: Das GUMG garantiert den Versicherungen unter bestimmten Bedingungen ein Mitwissen. Sie sollen laut Artikel 27 vor Abschluss einer Lebensversicherung, die über 400 000 Franken liegt, bestehende Gentests zur Risikoabklärung verlangen können. Versicherer dürfen sogar genetische Risikodiagnosen einbeziehen, wenn Kunden bei ihnen eine Spitalzusatzversicherung absichern oder andere Leistungen privat versichern wollen. Der medizinische Fortschritt ist hier Massstab. Zulässig sind Gen-Diagnosen etwa, wenn der «wissenschaftliche Wert der Untersuchung für die Prämienberechnung nachgewiesen ist». Wer aber entscheidet über den wissenschaftlichen Wert solcher Untersuchungen? Zunächst Experten, letztlich dann die Gerichte, die für teures Geld exemplarische Urteile zu fällen haben.
Schon heute ist das Arztgeheimnis zugunsten der Privatversicherer aufgeweicht. Erst nachdem das Parlament das GUMG im Oktober 2004 verabschiedet hatte, deckte der Bundesrat im Februar 2005 diesen Tatbestand im Bericht zum Postulat «Regelungslücken im medizinischen Datenschutz in den Sozialversicherungen» auf. Das Fazit des Berichts, zu dem das Institut für Gesundheitsrecht der Universität Neuenburg die Daten lieferte: Gesetze und Regeln sind zwar lückenlos, werden aber nicht eingehalten.
So geben befragte Krankenkassen freimütig zu, die Gesundheitsdaten zwischen der Sozialversicherung (obligatorische Krankenversicherung) und der Privatversicherung (Spitalzusatzversicherung) hin- und her zu schieben. Und Mitarbeiter der Versicherer können Patientengeschichten, die für den Vertrauensarzt bestimmt sind, ohne weiteres einsehen, weil diese elektronisch unter einheitlichem Code gespeichert sind.
Patientenschutz ausgehöhlt
Diese Praxis ist eigentlich gesetzeswidrig: Sozialversicherungen sind zur Schweigepflicht gegenüber Dritten verpflichtet. Und Privatversicherer sind solche Dritte, denn im Gegensatz zu den Sozialversicherern dürfen sie als profitorientierte Unternehmen kranke Patienten ausschliessen oder deren Gebühren drastisch erhöhen. Diesen Verstoss gegen das Gesetz listet der Bericht kommentarlos auf, was den Arzt Denz folgern lässt: «Der Bericht ist ein Blankoscheck zugunsten der heutigen Praxis.»
Er findet es zudem stossend, wie das Arztgeheimnis zunehmend durch die Verordnung ausgehöhlt wird. So misst das Krankenversicherungsgesetz (KVG) dem Arztgeheimnis und Patientenschutz grossen Wert bei und verpflichtet die Ärzte, Diagnosen erst auf speziellen Antrag und nur zuhanden des Vertrauensarztes der Krankenkasse zu liefern. Die Verordnung zum KVG hingegen macht diese Verpflichtung zur Makulatur. Sie verlangt nämlich, dass der Arzt die Rechnung mit einem Diagnosecode zu versehen hat.
Vergeblich hatte die Berner Konsumentenschützerin Simonetta Sommaruga 2001 noch als Nationalrätin versucht, den Datenschutz des Patienten anzumahnen. Heute verpflichtet der Tarmed-Vertrag bei der ambulanten Behandlung die Ärzte dazu, die Diagnose aufgrund von 100 Krankheitsbildern zu übermitteln.
Widersprüchliches Gesetz
Den Versicherern liegen somit die Gesundheitsdaten bald einmal detailliert vor. Der gläserne Patient wird immer mehr Wirklichkeit. Gesundheitsdaten wandern nicht nur von der Sozial- zur Privatversicherung, sondern geraten in gewissen Fällen auch schon in die Hände der Lebensversicherer. In der Praxis haben die Versicherer heute schon das Risiko zu ihren Gunsten reduziert. Und das GUMG gibt ihnen nun mit dem Zugang zu genetischen Daten ein weiteres Instrument in die Hand.
Das gleiche Gesetz, das das Individuum schützt und ihm eine umfassende Entscheidungsfähigkeit einräumt und verbietet, dass persönliche Daten an Dritte geliefert werden, lässt genau das durch die Hintertüre zu. Auch das nun in die Vernehmlassung geschickte Humanforschungsgesetz schützt die Person und wird doch nicht verhindern können, dass dieser Schutz in der Versicherungspraxis unterlaufen wird.
Diese Schwäche des Rechts hat vielleicht auch mit einer reduzierten Perspektive auf die ganze Thematik zu tun. Der isländischen Philosophin Sigridur Thorgeirsdottir (siehe Interview) fiel mit Befremden auf, wie Ethiker, Behördenvertreter und Politiker in der Schweiz Gesundheit und Krankheit fast ausschliesslich auf juristischer Ebene abhandeln und zufrieden sind, wenn Gesetze mit klaren Paragrafen vorliegen.
Die Philosophin berichtete an einer Tagung der Schweizer Stiftung für Datenschutz und Informationssicherheit zum Thema «Biobanken – Forschung und Persönlichkeitsschutz» über die Gendaten-Debatte in ihrem Heimatland. Sie forderte in ihrem Referat eine breite Diskussion über Sinn, Zweck und Kosten von Biodatenbanken.
Ich bin gesunder als du!
Ein Aspekt schliesslich ist bis jetzt gar nicht debattiert worden: Der Einzelne könnte seine Gen-Daten schamlos zu seinem Vorteil verwenden. Im harten Wettbewerb bei zunehmender Arbeitslosigkeit könnte der Gesunde dem Arbeitgeber freiwillig seine Gen- oder Gesundheits-Daten unter die Nase halten. Insbesondere dann, wenn eine belastbare Persönlichkeit gefragt ist. Bruno Baeriswyl, Präsident der Stiftung Datenschutz und Informationssicherheit, aber auch der Arzt Denz hält solch unlauteren Wettbewerb für möglich. Beiden kommt der Science-Fiction Film «Gattaca» von 1997 in den Sinn. Der Film, der den genetisch perfekten Menschen zum Thema macht, zeigt eine Welt auf, in der Menschen genetisch manipuliert werden, um Krankheitsrisiken auszuschalten. Menschen mit genetischen Fehlern haben kaum mehr Aussichten auf einen Job.
patpatpat - 12. Mär, 10:40